Dieses Lexikon der Dämonologie ist ein Lebenswerk: Seit über vierzig Jahren sammelt, archiviert, beschreibt und analysiert er die
dämonologischen Überlieferungen in all ihren Erscheinungsformen.
Inzwischen liegen mehr als 500 Stichworte und Lexikoneinträge mit historischen Illustrationen vor
– in Papierform und als Textdateien, die nun als ‚work in progress’ von Prof. Dr. Ruth Neubauer-Petzoldt
und Evan Neubauer als Online-Lexikon einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden.
Von A wie Ahti und Alberich über Baba Jaga, Bannik, Drache und Grendel bis Merlin, Onager und Sycorax reichen die Einträge.
Allerdings wird man hier ‚neue’ Dämonen aus der Literatur und den Filmen und Serien des 20. und 21. Jahrhunderts bis auf wenige Ausnahmen
vergeblich suchen. Diese multimediale Rezeption überlieferter populärer Dämonologie und ihre kreativen Umdeutungen hat so enorme Verbreitung gefunden
und ist so vielfältig, dass sie, ähnlich wie die Fantasy-Literatur, ein eigenes Forschungsfeld darstellt.
Auch konzentriert sich die Sammlung auf Europa und seine Überlieferungen seit der Antike, so dass Wesenheiten aus
der afrikanischen, asiatischen, ozeanischen, amerikanischen und indigenen Folklore und Dämonologie hier leider keine bzw.
nur dann eine Berücksichtigung finden können, soweit sie von der europäischen Literatur rezipiert wurden. mehr
Die Welt der Elementargeister und Dämonen, der Fabelwesen und Totengeister, der Hexen, Zauberer, Zwerge und vielfältigen Sagengestalten fasziniert den Erzählforscher und Ethnologen Prof. Dr. Leander Petzoldt seit seiner Dissertation Der Tote als Gast. Volkssage und Exempel (1968). Seitdem hat er sich in einer Vielzahl von Publikationen mit der Dämonologie, dem magischen Denken in der volkstümlichen Überlieferung und mit der europäischen Sagenwelt befasst.
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Leander_Petzoldt https://www.leanderpetzoldt.at/
Einen kleinen Ausschnitt finden Sie in dem Band Kleines Lexikon der Dämonen und Elementargeister, in der 5. Auflage 2015 bei C.H. Beck erschienen https://www.chbeck.de/petzoldt-kleines-lexikon-daemonen-elementargeister/product/13698638
Das Lexikon soll ein Bild der kultur- und religionshistorischen sowie der psychologischen Hintergründe dämonischer Wesenheiten, ihrer geographischen Verbreitung und etymologischen Bedeutung vermitteln. Dabei wird auf Quellen verschiedenster Art, antike medizinisch-astrologische Werke, einschlägige mittelalterliche Literatur und die Schriften der Naturphilosophen des 15. und 16. Jahrhunderts bis hin zur okkultistischen Literatur der Neuzeit, zurückgegriffen. Daneben werden auch volkskundlich ethnologische Aufzeichnungen, die die orale und literale, die mündliche und schriftliche Tradition Europas und der europäisch beeinflussten Kulturen berücksichtigen, sowie Materialien der großen ethnologischen Sammelaktionen des 19. und 20 Jahrhunderts zu einzelnen Themen ausgewertet. Durch die Einbeziehung der frühneuzeitlichen humanistischen Literatur sowie der oralen populären Erzählüberlieferung der letzten zweihundert Jahre wird hier Neuland betreten, da solche Quellen bisher nur in Einzelfällen ausgewertet wurden.
Wir freuen uns über Rückmeldungen und Anregungen von Ihnen, liebe interessierte Besucherinnen und Besucher dieser Homepage. Bitte haben Sie im Blick, dass dies ein gewaltiges Unternehmen und work in progress ist; wir wollen Ihnen so schnell wie möglich die Einträge zur Verfügung stellen, werden diese aber erst nach und nach überarbeiten und aktualisieren können. Sie erreichen die Redaktion des Lexikons der Dämonologie unter: kontakt@daemonen-lexikon.de weniger


Fabelwesen aus: Friedrich Justin Bertuch, Bilderbuch für Kinder, Weimar 1790-1830.
Die Welt der Elementargeister und Dämonen, der Fabelwesen und Totengeister, der Hexen, Zauberer, Zwerge und vielfältigen Sagengestalten fasziniert den Erzählforscher und Ethnologen Prof. Dr. Leander Petzoldt seit seiner Dissertation Der Tote als Gast. Volkssage und Exempel (1968). Seitdem hat er sich in einer Vielzahl von Publikationen mit der Dämonologie, dem magischen Denken in der volkstümlichen Überlieferung und mit der europäischen Sagenwelt befasst.
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Leander_Petzoldt https://www.leanderpetzoldt.at/
Einen kleinen Ausschnitt finden Sie in dem Band Kleines Lexikon der Dämonen und Elementargeister, in der 5. Auflage 2015 bei C.H. Beck erschienen https://www.chbeck.de/petzoldt-kleines-lexikon-daemonen-elementargeister/product/13698638
Das Lexikon soll ein Bild der kultur- und religionshistorischen sowie der psychologischen Hintergründe dämonischer Wesenheiten, ihrer geographischen Verbreitung und etymologischen Bedeutung vermitteln. Dabei wird auf Quellen verschiedenster Art, antike medizinisch-astrologische Werke, einschlägige mittelalterliche Literatur und die Schriften der Naturphilosophen des 15. und 16. Jahrhunderts bis hin zur okkultistischen Literatur der Neuzeit, zurückgegriffen. Daneben werden auch volkskundlich ethnologische Aufzeichnungen, die die orale und literale, die mündliche und schriftliche Tradition Europas und der europäisch beeinflussten Kulturen berücksichtigen, sowie Materialien der großen ethnologischen Sammelaktionen des 19. und 20 Jahrhunderts zu einzelnen Themen ausgewertet. Durch die Einbeziehung der frühneuzeitlichen humanistischen Literatur sowie der oralen populären Erzählüberlieferung der letzten zweihundert Jahre wird hier Neuland betreten, da solche Quellen bisher nur in Einzelfällen ausgewertet wurden.
Wir freuen uns über Rückmeldungen und Anregungen von Ihnen, liebe interessierte Besucherinnen und Besucher dieser Homepage. Bitte haben Sie im Blick, dass dies ein gewaltiges Unternehmen und work in progress ist; wir wollen Ihnen so schnell wie möglich die Einträge zur Verfügung stellen, werden diese aber erst nach und nach überarbeiten und aktualisieren können. Sie erreichen die Redaktion des Lexikons der Dämonologie unter: kontakt@daemonen-lexikon.de weniger


Fabelwesen aus: Friedrich Justin Bertuch, Bilderbuch für Kinder, Weimar 1790-1830.
Einleitung
von Prof. Dr. Marco Frenschkowski
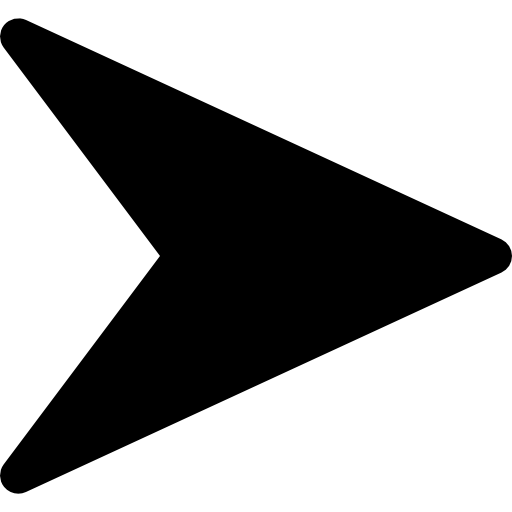
„Dämonen“ sind ein Faszinans der Kulturgeschichte
„Dämonen“ sind ein Faszinans der Kulturgeschichte, eine Chiffre für das Abgründige im Menschen (nicht nur einfach für das „Böse“),
für das Fremde, Änigmatische in unserer Lebenswelt, für das „Andere“, das in irgendeiner Weise doch wir selbst sind. Man kann sie
als ein Universale der Religions- und Kulturgeschichte verstehen, steht dabei aber in Gefahr, die kulturellen Unterschiede zu
nivellieren, in denen Menschen von diesem „Anderen“ sprechen. Sie sind nicht identisch mit dem weiteren Bereich der numinosen
und übernatürlichen Wesen, aber die Grenzen sind schwierig zu ziehen. Es ist in den folgenden Zeilen ein gewisser Anmarschweg
erforderlich, um verständlich zu machen, was der Sinn und Zweck eines „Dämonologischen Lexikons“ ist. Wir assoziieren im heutigen
Sprachgebrauch mit Dämonen das „Böse“, aber das hat sich erst in der christlichen Antike so durchgesetzt (im Griechischen sind Dämonen
anfänglich keineswegs „böse“, stehen aber meist in der supranaturalen Hierarchie unter den Göttern). Die ethischen Kategorien des Guten
und Bösen greifen auch kaum, wenn die Dämonen der populären Erzählkulturen beschrieben werden sollen, obwohl der christlich-jüdische
Kontext sie deambiguiert und zu Trägern des Bösen macht. Zwei Beispiele machen das sofort sichtbar: Engel sind im jüdisch-christlichen
Raum gerade keine Dämonen: aber in den langen Dämonenlisten der abendländischen magischen Literatur begegnen eben auch Engelnamen, und
überhaupt ist es in der Beschwörungsmagie der Zauberbücher kaum möglich, zwischen beiden Kategorien zu unterscheiden. Engel sind hier
gefährliche Mächte, die sich der Magier oder die Magierin aber zu Diensten machen kann, und dann kaum von Dämonen zu unterscheiden.
Naturgeister, Elementarwesen sind nicht weniger ein Universale menschheitlicher Naturerfahrung, Naturdeutung und Naturmythologie: aber
vielfach sind auch sie weder einfach „gut“ noch einfach „böse“. Sie können freilich eine dämonische Dimension annehmen, zumal sie
vielfach nicht weniger als diese bedrohlich, ja verderblich für den Menschen sein können. Aber das Spektrum ihrer möglichen Verhältnisse
zum Menschen ist groß, und nicht weniger das des rituellen und alltäglichen Umganges mit ihnen, zwischen Bannung, Meidung und Beschwörung.
In der Sage begegnen „Dämonen“ in einem weiten Sinn oft geradezu zufällig: der Mensch gerät dann ohne Absicht in ihren Bereich, und so weiter.
Die Forschung hat sich weniger um eine „exakte Definition“ bemüht (die es kaum geben kann), sondern eher darum, das Spektrum dieser Figuren der Imagination zu beschreiben und auszuloten. Das kann nur in einer geschichtlichen und kulturellen Kontextualisierung geschehen, denn Dämonen sind wie alle mythologischen Wesen auch imaginierte Funktionsträger in den konkreten kulturellen und religiösen Systemen, in denen wir leben. Zumindest wird man sagen können, dass Dämonen, wie weit wir ihr Spektrum auch ausziehen, Fokussierungsfiguren sind. In ihnen konzentrieren sich Erfahrungen, vor allem solche ganz un-alltäglicher und numinoser Art. Der Umgang mit ihnen ist dann aber vielfach wieder Teil des Alltags. Nach den Dämonen zu fragen, heißt auch nach den Erfahrungen zu fragen, die dämonologisch gedeutet werden. Leider lauern hier Klischees an jeder Ecke (nach wie vor kann man lesen, in der Welt der Bibel oder sogar der Antike seien Krankheiten durchgehend als Dämonenwerk gedeutet worden: davon kann natürlich gar keine Rede sein).
Wenn eine Gesellschaft nicht mehr an Dämonen glaubt (was ja ihr gutes Recht ist), so hört sie doch im Allgemeinen nicht auf, zu dämonisieren: Menschen, Gruppen, andere Ethnien, „Feinde“ und „Außenseiter“. Ikonen des Bösen, Chiffren des Gefährlichen, des destruktiv Anderen stellen sich ein, wenn Dämonen von der Bühne abtreten. Menschen, die eigentlich nichts Übernatürliches an sich haben, wie Hannibal Lecter oder auch Hitler nehmen „dämonische Züge“ an, und das trifft reale wie fiktionale Menschen. Auch dabei ist die Grenze zwischen dem Menschlichen und dem Dämonischen durchlässig, und das auch gerade da, wo es in einem Weltbild „keine Dämonen gibt“. Sie können gedeutet, interpretiert werden, in sozialwissenschaftlichen, kognitionswissenschaftlichen, tiefenpsychologischen, rhetorischen, philosophischen und religiösen Kategorien, sie können zum Gegenstand der Kunst werden, ihre Existenz oder Nichtexistenz können gleichermaßen energisch behauptet werden: das ändert aber fast gar nichts an ihrem Faszinans und ihrem Schrecken. Kann man vielleicht sogar sagen, dass es sozusagen egal ist, in welchem Sinn sie „existieren“, denn ihre „Bedeutung“ hängt daran gar nicht? Das ist aber vielleicht doch etwas sehr modern oder postmodern gesprochen: denn in älteren Gesellschaften (und in nicht wenigen unserer Gegenwart) steht ihre „Realität“ außer Frage. Auch das muss eine Dämonologie reflektieren: die verschiedenen Arten der Existenz und Präsenz der Dämonen in unseren Geschichten, Büchern, Filmen, Träumen, Alpträumen, in unserer Kunst und Literatur. Die Grenze zwischen Glauben und Aberglauben (also dem, was man „mit schlechtem Gewissen“ glaubt, oder was von epistemologischen Herrschaftsdiskursen ausgegrenzt wird) kann fließend oder schwach ausgeprägt sein, und ist zudem diskurshafter Natur. Je energischer ihre Irrealität entlarvt wird (daran soll kein Zweifel ausgesprochen sein), desto stärker können die Dämonen durch die Hintertür der Imagination zurückkehren und das Verdrängte zur Sprache bringen. Das haben sie mit dem „Phantastischen“ gemeinsam, das ja eine Präsenzweise des gesellschaftlich Verdrängten ist. Das „Normale“ in den meisten Gesellschaften aber ist die Selbstverständlichkeit ihrer Nachbarschaft mit den Menschen, um die Ecke, außerhalb der Stadt oder des Dorfes oder auch mitten in diesen.
Die Forschung hat sich weniger um eine „exakte Definition“ bemüht (die es kaum geben kann), sondern eher darum, das Spektrum dieser Figuren der Imagination zu beschreiben und auszuloten. Das kann nur in einer geschichtlichen und kulturellen Kontextualisierung geschehen, denn Dämonen sind wie alle mythologischen Wesen auch imaginierte Funktionsträger in den konkreten kulturellen und religiösen Systemen, in denen wir leben. Zumindest wird man sagen können, dass Dämonen, wie weit wir ihr Spektrum auch ausziehen, Fokussierungsfiguren sind. In ihnen konzentrieren sich Erfahrungen, vor allem solche ganz un-alltäglicher und numinoser Art. Der Umgang mit ihnen ist dann aber vielfach wieder Teil des Alltags. Nach den Dämonen zu fragen, heißt auch nach den Erfahrungen zu fragen, die dämonologisch gedeutet werden. Leider lauern hier Klischees an jeder Ecke (nach wie vor kann man lesen, in der Welt der Bibel oder sogar der Antike seien Krankheiten durchgehend als Dämonenwerk gedeutet worden: davon kann natürlich gar keine Rede sein).
Wenn eine Gesellschaft nicht mehr an Dämonen glaubt (was ja ihr gutes Recht ist), so hört sie doch im Allgemeinen nicht auf, zu dämonisieren: Menschen, Gruppen, andere Ethnien, „Feinde“ und „Außenseiter“. Ikonen des Bösen, Chiffren des Gefährlichen, des destruktiv Anderen stellen sich ein, wenn Dämonen von der Bühne abtreten. Menschen, die eigentlich nichts Übernatürliches an sich haben, wie Hannibal Lecter oder auch Hitler nehmen „dämonische Züge“ an, und das trifft reale wie fiktionale Menschen. Auch dabei ist die Grenze zwischen dem Menschlichen und dem Dämonischen durchlässig, und das auch gerade da, wo es in einem Weltbild „keine Dämonen gibt“. Sie können gedeutet, interpretiert werden, in sozialwissenschaftlichen, kognitionswissenschaftlichen, tiefenpsychologischen, rhetorischen, philosophischen und religiösen Kategorien, sie können zum Gegenstand der Kunst werden, ihre Existenz oder Nichtexistenz können gleichermaßen energisch behauptet werden: das ändert aber fast gar nichts an ihrem Faszinans und ihrem Schrecken. Kann man vielleicht sogar sagen, dass es sozusagen egal ist, in welchem Sinn sie „existieren“, denn ihre „Bedeutung“ hängt daran gar nicht? Das ist aber vielleicht doch etwas sehr modern oder postmodern gesprochen: denn in älteren Gesellschaften (und in nicht wenigen unserer Gegenwart) steht ihre „Realität“ außer Frage. Auch das muss eine Dämonologie reflektieren: die verschiedenen Arten der Existenz und Präsenz der Dämonen in unseren Geschichten, Büchern, Filmen, Träumen, Alpträumen, in unserer Kunst und Literatur. Die Grenze zwischen Glauben und Aberglauben (also dem, was man „mit schlechtem Gewissen“ glaubt, oder was von epistemologischen Herrschaftsdiskursen ausgegrenzt wird) kann fließend oder schwach ausgeprägt sein, und ist zudem diskurshafter Natur. Je energischer ihre Irrealität entlarvt wird (daran soll kein Zweifel ausgesprochen sein), desto stärker können die Dämonen durch die Hintertür der Imagination zurückkehren und das Verdrängte zur Sprache bringen. Das haben sie mit dem „Phantastischen“ gemeinsam, das ja eine Präsenzweise des gesellschaftlich Verdrängten ist. Das „Normale“ in den meisten Gesellschaften aber ist die Selbstverständlichkeit ihrer Nachbarschaft mit den Menschen, um die Ecke, außerhalb der Stadt oder des Dorfes oder auch mitten in diesen.
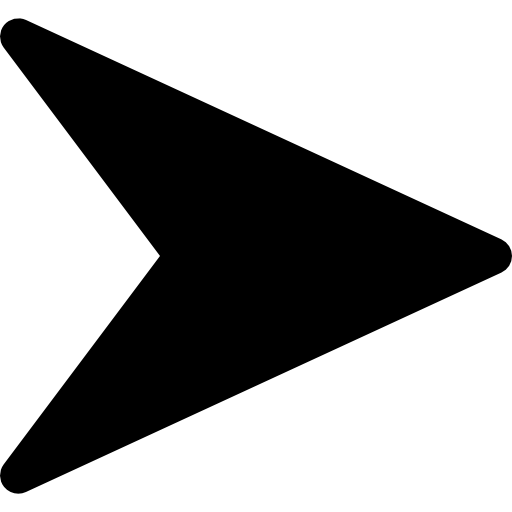
Dämonologie in der ethnologischen Forschungsgeschichte
Die Rede von Dämonen ist niemals harmlos, auch wenn diese Dämonen in den Raum eines vergangenen Glaubens zurücksinken.
Die ältere Volkskunde (die wir heute meist europäische Ethnologie nennen, als Teil der vergleichenden und empirischen
Kulturwissenschaften) hat sie früher gerne als etwas „Populäres“, von der Bildungselite Abgetrenntes gesehen: dieser
apologetische Standpunkt ist heute aufgegeben. An Dämonen haben alle Gruppen, Schichten, Milieus, alle sozialen Levels
in Gesellschaften geglaubt, und tun es heute. Und wenn sie nicht an sie glauben, können sie sie dennoch fürchten – oder
gerade ihre Hilfe suchen. Das gehört zum Wesen dessen, was man ehemals die „niedere Mythologie“ nannte (auch das eine
Formulierung des 19. Jhdts., die wir sozusagen zitathaft verwenden), dass ihr Verhältnis zur Wirklichkeit ein schillerndes,
oszillierendes ist. Dämonen sind selbst in älteren Gesellschaften nicht unbedingt einfach „real“: und doch Teil der
alltäglichen Praxis, der alltäglichen Furcht, der alltäglichen Riten. Ihre Realität „geschieht“, sie leben in den
Ritualen, mit denen sie abgewehrt oder aber – gesucht werden. In religiösen Systemen können sie Gegenstand der Reflexion
werden, wie sie in den Geschichten der Tradition Figuren der Mythologie sind. Das ist genau der Punkt, an dem Dämonologien
entstehen, entfaltete Imaginationen, die mit den Systemen der Religion interagieren (aber mit diesen nicht einfach
identisch sind). Das europäische Mittelalter, um nur dieses Beispiel zu nennen, kennt Dämonologien, Dämonen,
Naturgeister innerhalb kirchlicher gedanklicher Systeme und andererseits auch weitab von diesen. Der Unterschied
war in der Literatur nicht einmal unbedingt immer deutlich. Dämonen gehören eben auch zum Flatterrand gesellschaftlicher
Wirklichkeiten, zu den Grenzbewohnern der Wissenssysteme. Andererseits können sie im Denken der Menschen erschreckend real,
präsent sein und legitimieren dann auch gewalttätige Ausgrenzungen gegenüber Menschen, die man mit diesen Dämonen im
Bund glaubt.
Ihre Existenz kann (nicht nur in unseren unmittelbar modernen Gesellschaften) eine gebrochene Existenz sein: wenn sie ganz in den Raum der Fantasie gedrängt werden, ohne aus der Tradition zu verschwinden. Das geschieht auch in nicht-westlichen Gesellschaften, z. B. in Japan und China, die überaus komplexe Dämonologien besitzen, die auch in modernen Transformationen zum Zuge kommen, oder in denen (wie im Buddhismus) Dämonen oft sehr dezidiert Chiffren für seelisch-mentale Zustände sind. Auch in modernen Formen, die keine Tatsächlichkeit beanspruchen, können sie erstaunlich aktiv, wirksam, mächtig sein. Mann kann das in tiefenpsychologischen Kategorien interpretieren (nicht nur solchen C. G. Jungs), in esoterischen und magischen, in sozialgeschichtlichen, in religiösen: oder man kann auf Deutungen verzichten, und das Eigenleben der Dämonen in Film, Kunst, Literatur als solches in den Blick nehmen, ohne es zu erklären. Erklärungen sind notwendig: aber sie pflegen in solchen Fällen nur Halbwahrheiten darzustellen, und sie können die Fülle der Phänomene nicht einfangen. Wie alle mythischen Figuren und Narrative lassen sie sich nur begrenzt in andere Aussageweisen übersetzen. Dämonen sind eine Facette des Humanums, gerade weil sie das Unmenschliche, das Widermenschliche, das Abgründige, aber auch faszinierend Andere fokussieren können. Sie sind real, auch wenn es sie nicht gibt, Teil der Seele, auch wenn sie aus dieser ausgesperrt werden.
Befreiungserfahrungen gegenüber dem Dämonischen (unter Umständen als Exorzismen ritualisiert) sind ebenfalls in den meisten, vielleicht in allen Gesellschaften bekannt (wie „global“ man das sagen will, hängt an Enge und Weite unserer Begriffe), und das gilt noch stärker für apotropäische Riten, die das Dämonische abwehren, aus dem Alltag heraushalten sollten. „Gefährdet“ durch Dämonen sind vor allem die Grenzbereiche des Lebens, Schwangerschaft und Geburt, Pubertät und Initiation, Tod und Trauer, daneben auch die körperlichen Funktionen und ihre „Orte“. Sie sind daher in besonderer Weise Stätten des Apotropäischen, in denen Dämonen begegnet wird, und in denen Dämonen abgewehrt werden. Sie können „draußen“ in der Wildnis auftauchen, aber auch an den „verborgenen“ Orten des eigenen Hauses. Von Dämonen ist in Bildern, Erzählungen, Liedern die Rede, in Interjektionen („Ei der Daus“), in entfalteten Mythologien und Ritualsystemen. Ihre Namen und „Identitäten“, wenn wir so sagen dürfen, unterliegen den kuriosesten Fluktuationen (z. B. wechseln sie gelegentlich das Geschlecht).
Ein kurzes Wort hier noch zum „Teufel“: er ist vielfach ein Dämon, aber in seinen biblischen Wurzeln (die den Dualismus abwehren, und ihn immer nur als gefallenes Geschöpf Gottes sehen) doch etwas anderes. Darüber hat der Verfasser dieses Vorwortes an verschiedenen Stellen gehandelt, zuletzt im Artikel „Teufel“ des Reallexikons für Antike und Christentum, wo die frühe Geschichte dieser Figur in beträchtlicher Ausführlichkeit analysiert ist. Ich weise darauf kurz hin, weil die religiöse, symbolische Rede vom Teufel mit derjenigen von den „Dämonen“ nicht identisch ist, und auch verschiedene imaginative Bedürfnisse bedient. Aber das kann hier nicht vertieft werden. Auch Geister sind mit Dämonen natürlich nicht identisch, aber oft ist es auch hier schwierig, Grenzen zu ziehen, und ein zu enger Blick verhindert wichtige Entdeckungen.
Dämonen sind ein Faszinans. In der Sage bewohnen sie den Bereich vor der Haustür, in der Nähe der Lebenswelt, und können gelegentlich bedrohlich oder auch großzügig in diese eindringen. Im Märchen sind sie eher weiter entfernt, begegnen dem Wandernden des Märchens in einer Anderswelt oder an der Grenze zu dieser. In der Legende werden sie vom „Heiligen“ bezwungen und vertrieben, im Schwank lacht man über sie, wenn sie erfolglos oder tölpelhaft auftreten. Aus der Seele geboren, werden sie in der Moderne in die Seele zurückgedrängt, wo sie im Untergrund mächtig rumoren können. Vor allem sind sie Gegenstand von Geschichten, Brauchtum, Ritualen. Sie bilden einen Teil eines umfassenden mythologischen Imaginariums, mit dem wir unsere Welt zu einem bewohnbaren Raum machen. In der Kahlheit des Tatsächlichen, Vorfindlichen kann sich der Mensch nicht geistig beheimaten: es muss Türen ins Imaginative, Mythologische aufweisen. Selbst wenn man durch diese Türen nicht hindurchgehen will, braucht man sie, um überhaupt als Mensch mit Verstand und Fantasie leben zu können.
Das Motivrepertoire der Dämonologie ist bei aller Vielfalt doch begrenzt. Das gilt auch im globalen Vergleich. Ohne diese vergleichende Perspektive stellen sich Kurzsichtigkeiten der Analyse ein: das Normale erscheint dann plötzlich als ein Besonderes, das Gemeinsame z. B. als ein allein Regionales. Andererseits unterliegt der Vergleich besonderen Gefahren und Fallen, die ihn in den Kulturwissenschaften auch suspekt gemacht haben. Zu leicht schafft unsere Brille erst die Phänomene, die wir dann vergleichen, und alle Kategorien, in denen wir Kulturen beschreiben, stammen aus konkreten Kulturen und bleiben ihnen verbunden. (Die wissenschaftliche Terminologie kann das verschleiern, aber es kann leicht wieder sichtbar gemacht werden.) Das ist Risiko und Falle des Vergleichs, und doch gibt es ohne ihn kein Verstehen, wenn er sich diesen Fragen stellt. Der Vergleich ist unsere Brille: aber ohne diese Brille sehen wir gar nichts. Vor dem Vergleich und zugleich hinter ihm liegt das Sammeln, das zur Kenntnisnehmen der Vielfalt, mit möglichst offenen Kriterien. In diesem Sinn ist das vorliegende Buch keine Dämonologie (auch keine volkskundliche oder ethnologische), sondern eine Zusammenschau dessen, worüber ein solches Projekt nachzudenken hat, im Fragediskurs sehr verschiedener Wissenschaften. Es stellt das Material bereit, in seiner ganzen Breite, mit der sich jede Analyse des Dämonischen auseinanderzusetzen hat: es sichtet, was hier zu bedenken ist.
Ihre Existenz kann (nicht nur in unseren unmittelbar modernen Gesellschaften) eine gebrochene Existenz sein: wenn sie ganz in den Raum der Fantasie gedrängt werden, ohne aus der Tradition zu verschwinden. Das geschieht auch in nicht-westlichen Gesellschaften, z. B. in Japan und China, die überaus komplexe Dämonologien besitzen, die auch in modernen Transformationen zum Zuge kommen, oder in denen (wie im Buddhismus) Dämonen oft sehr dezidiert Chiffren für seelisch-mentale Zustände sind. Auch in modernen Formen, die keine Tatsächlichkeit beanspruchen, können sie erstaunlich aktiv, wirksam, mächtig sein. Mann kann das in tiefenpsychologischen Kategorien interpretieren (nicht nur solchen C. G. Jungs), in esoterischen und magischen, in sozialgeschichtlichen, in religiösen: oder man kann auf Deutungen verzichten, und das Eigenleben der Dämonen in Film, Kunst, Literatur als solches in den Blick nehmen, ohne es zu erklären. Erklärungen sind notwendig: aber sie pflegen in solchen Fällen nur Halbwahrheiten darzustellen, und sie können die Fülle der Phänomene nicht einfangen. Wie alle mythischen Figuren und Narrative lassen sie sich nur begrenzt in andere Aussageweisen übersetzen. Dämonen sind eine Facette des Humanums, gerade weil sie das Unmenschliche, das Widermenschliche, das Abgründige, aber auch faszinierend Andere fokussieren können. Sie sind real, auch wenn es sie nicht gibt, Teil der Seele, auch wenn sie aus dieser ausgesperrt werden.
Befreiungserfahrungen gegenüber dem Dämonischen (unter Umständen als Exorzismen ritualisiert) sind ebenfalls in den meisten, vielleicht in allen Gesellschaften bekannt (wie „global“ man das sagen will, hängt an Enge und Weite unserer Begriffe), und das gilt noch stärker für apotropäische Riten, die das Dämonische abwehren, aus dem Alltag heraushalten sollten. „Gefährdet“ durch Dämonen sind vor allem die Grenzbereiche des Lebens, Schwangerschaft und Geburt, Pubertät und Initiation, Tod und Trauer, daneben auch die körperlichen Funktionen und ihre „Orte“. Sie sind daher in besonderer Weise Stätten des Apotropäischen, in denen Dämonen begegnet wird, und in denen Dämonen abgewehrt werden. Sie können „draußen“ in der Wildnis auftauchen, aber auch an den „verborgenen“ Orten des eigenen Hauses. Von Dämonen ist in Bildern, Erzählungen, Liedern die Rede, in Interjektionen („Ei der Daus“), in entfalteten Mythologien und Ritualsystemen. Ihre Namen und „Identitäten“, wenn wir so sagen dürfen, unterliegen den kuriosesten Fluktuationen (z. B. wechseln sie gelegentlich das Geschlecht).
Ein kurzes Wort hier noch zum „Teufel“: er ist vielfach ein Dämon, aber in seinen biblischen Wurzeln (die den Dualismus abwehren, und ihn immer nur als gefallenes Geschöpf Gottes sehen) doch etwas anderes. Darüber hat der Verfasser dieses Vorwortes an verschiedenen Stellen gehandelt, zuletzt im Artikel „Teufel“ des Reallexikons für Antike und Christentum, wo die frühe Geschichte dieser Figur in beträchtlicher Ausführlichkeit analysiert ist. Ich weise darauf kurz hin, weil die religiöse, symbolische Rede vom Teufel mit derjenigen von den „Dämonen“ nicht identisch ist, und auch verschiedene imaginative Bedürfnisse bedient. Aber das kann hier nicht vertieft werden. Auch Geister sind mit Dämonen natürlich nicht identisch, aber oft ist es auch hier schwierig, Grenzen zu ziehen, und ein zu enger Blick verhindert wichtige Entdeckungen.
Dämonen sind ein Faszinans. In der Sage bewohnen sie den Bereich vor der Haustür, in der Nähe der Lebenswelt, und können gelegentlich bedrohlich oder auch großzügig in diese eindringen. Im Märchen sind sie eher weiter entfernt, begegnen dem Wandernden des Märchens in einer Anderswelt oder an der Grenze zu dieser. In der Legende werden sie vom „Heiligen“ bezwungen und vertrieben, im Schwank lacht man über sie, wenn sie erfolglos oder tölpelhaft auftreten. Aus der Seele geboren, werden sie in der Moderne in die Seele zurückgedrängt, wo sie im Untergrund mächtig rumoren können. Vor allem sind sie Gegenstand von Geschichten, Brauchtum, Ritualen. Sie bilden einen Teil eines umfassenden mythologischen Imaginariums, mit dem wir unsere Welt zu einem bewohnbaren Raum machen. In der Kahlheit des Tatsächlichen, Vorfindlichen kann sich der Mensch nicht geistig beheimaten: es muss Türen ins Imaginative, Mythologische aufweisen. Selbst wenn man durch diese Türen nicht hindurchgehen will, braucht man sie, um überhaupt als Mensch mit Verstand und Fantasie leben zu können.
Das Motivrepertoire der Dämonologie ist bei aller Vielfalt doch begrenzt. Das gilt auch im globalen Vergleich. Ohne diese vergleichende Perspektive stellen sich Kurzsichtigkeiten der Analyse ein: das Normale erscheint dann plötzlich als ein Besonderes, das Gemeinsame z. B. als ein allein Regionales. Andererseits unterliegt der Vergleich besonderen Gefahren und Fallen, die ihn in den Kulturwissenschaften auch suspekt gemacht haben. Zu leicht schafft unsere Brille erst die Phänomene, die wir dann vergleichen, und alle Kategorien, in denen wir Kulturen beschreiben, stammen aus konkreten Kulturen und bleiben ihnen verbunden. (Die wissenschaftliche Terminologie kann das verschleiern, aber es kann leicht wieder sichtbar gemacht werden.) Das ist Risiko und Falle des Vergleichs, und doch gibt es ohne ihn kein Verstehen, wenn er sich diesen Fragen stellt. Der Vergleich ist unsere Brille: aber ohne diese Brille sehen wir gar nichts. Vor dem Vergleich und zugleich hinter ihm liegt das Sammeln, das zur Kenntnisnehmen der Vielfalt, mit möglichst offenen Kriterien. In diesem Sinn ist das vorliegende Buch keine Dämonologie (auch keine volkskundliche oder ethnologische), sondern eine Zusammenschau dessen, worüber ein solches Projekt nachzudenken hat, im Fragediskurs sehr verschiedener Wissenschaften. Es stellt das Material bereit, in seiner ganzen Breite, mit der sich jede Analyse des Dämonischen auseinanderzusetzen hat: es sichtet, was hier zu bedenken ist.
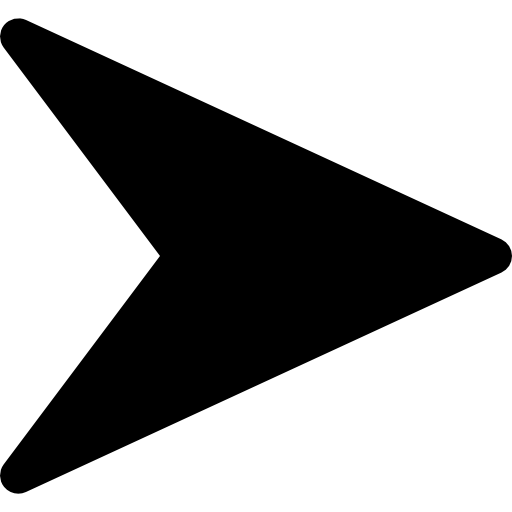
Zu dem vorliegenden Lexikon der Dämonologie
Das „Wissen“ um die Dämonen ist ein kulturell vergangenes Wissen, verdrängt, vergessen, folklorisiert, literarisiert
(all das sind Verharmlosungsdynamiken). Hier kommt nun Leander Petzoldt ins Spiel: Das vorliegenden Lexikon, sein letztes Buch
und ein wahres Magnum Opus, sichtet weitausholend die dämonischen Figuren v.a. der abendländischen Traditionen, mit weltweiten
Ausblicken. Diese werden beschrieben, historisiert, kontextualisiert, auf ihre Quellen hin befragt. Was ist die Funktion eines
solchen Lexikons, das eine wahre Enzyklopädie darstellt? Sicher ist auch von Kuriosem die Rede, und sicher hat das Blättern in
einem solchen Werk etwas Unterhaltendes. Aber es geht doch auch um etwas anderes: um ein verdrängtes kulturelles Wissen, das Bereiche
des Menschlichen, der menschlichen Erfahrung, der menschlichen erzählten Welt zum Ausdruck bringt, ohne die wir das Böse, das
Abgründige, das Abjekte, das Grauenvolle, aber auch das Verschmitzte, Verspielte, Närrische nicht verstehen könnten. In abstrakten
Begriffen wäre es nicht einzufangen. Die Vielnamigkeit der Dämonen (kein mythologischer Name hat in den europäischen Sprachen mehr
Synonyme als v.a. derjenige des Teufels) ist selbst ein Hinweis auf das Schillernde dieser Figuren, deren Identitäten verschwimmen,
sich überschneiden. Ihre „Gleichsetzung“ ist selbst ein Akt der dämonologischen Theorie (wie die Gleichsetzung von Göttern ein Akt
einer Theologie ist, kein religionswissenschaftlicher). Bei allem Vergleichbaren bleiben viele Figuren scharf konturiert, an
bestimmte Orte, Lokalitäten, Zeiten, ja Personen gebunden. Das macht sie zu einem sehr spezifischen Fenster auf die europäische
Kulturgeschichte: zeige mir deine Dämonen, und ich sage dir, wer du bist. Das setzt sich in die Moderne fort. Die Ikononographie
und Prosopographie des Dämonischen ändert sich rasch, und sie ist eine präzise benennbare Funktion spezifischer gesellschaftlicher
Konstellationen oder, wie wir vielleicht sagen dürfen, Leitimaginationen. Jede Gesellschaft schafft sich ja auch die Monstren,
die sie verdient. Es ist etwas anderes, ob das Bahnhofsschrifttum einer Gesellschaft (sagen wir es ausnahmsweise einmal etwas von
oben herab) von Vampiren, Nazis oder Zombies erzählt. Es ist etwas anderes, ob der dämonisierte Bösewicht Dr. Moriarty, Fu Manchu
(der ab 1913 die Angst vor einer chinesischen Weltherrschaft literarisiert) oder Hannibal Lecter ist. Der Erstere fragt, was
geschieht, wenn überlegener Intellekt nur böse ist; der letztere, wenn sich die Kenntnis der seelischen Tiefen und Untergründe
mit diesem Bösen selbst verbündet, usw. Was besagt die Faszination mit dem Massenmörder, wenn dieser (wie ehemals der Vampir,
dem das Gleiche widerfuhr) aus einer Ikone des Bösen zu einer schillernden Identifikationsfigur wird? Wie leben hier die Dämonen
fort oder vielleicht auch neu auf? Das wirklich Interessante ist, wie und warum wir Sympathien mit diesen Figuren haben,
warum wir gerne von den Dämonen erzählen. Ist die Erzählung (auch die literarische und cineastische) eine Form des Exorzismus? All das sind Fragen, die wir uns vielleicht auch einmal stellen können, wenn wir das folgende Lexikon lesen.
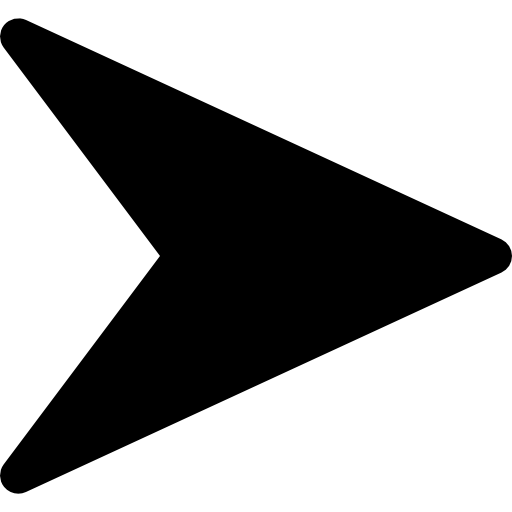
Auflistungen von Dämonen und Vorläufer dieses Lexikons
Namenslisten und überhaupt „systematische“ Dämonologie haben eine lange, eine erstaunlich lange Tradition.
Sie müssen – wie alle Listen – ein eigenes imaginatives Bedürfnis befriedigen. Vielleicht sollten sie das Bedrohliche,
das Irrationale etwas beherrschbarer machen? Etwas zu überschauen heißt ja, von ihm nicht mehr völlig überrascht werden
zu können. Dämonenlisten kennt daher schon die babylonische und assyrische Literatur. Das „Testament Salomos“, eine aus
jüdischen Quellen schöpfende christliche Schrift etwa des 3.-5. Jhdts. (in Teilen vielleicht schon älter) lässt den
sagenhaften König Salomon als Bezwinger der Dämonen auftreten, und diese werden dabei mit ihren Namen, Attributen,
Machtbereichen, ihrer Ikonographie (also ihrer äußeren Erscheinung) detailliert beschrieben. Das ist in gewisser
Hinsicht die erste wirklich umfassende Dämonenliste des Abendlandes (Ansätze solcher Listen sind aber wie gesagt auch
im griechisch-römischen Bereich bereits älter, im Orient ohnehin). Judentum, Christentum und Islam haben solche Listen
produziert, aber auch die asiatischen Religionen, in besonderer Ausführlichkeit der Buddhismus. Für die tribalen
Religionen haben es dann die Ethnologie und früher schon die Berichte der Reisenden und Missionare unternommen, ihre
Numina, Göttinnen und Götter und eben auch Dämonen zu sammeln, zu sichten, zu ordnen – im Allgemeinen nach westlichen
Kriterien. Die jüngere Forschung hat dabei vor allem die Kategorien in Frage stellen müssen, in denen das geschah.
Es war schon eine wesentliche Bedingung für die Entstehung einer Religionswissenschaft gewesen, als sich Reisende im
17. und 18. weigerten, die Numina der besuchten Ethnien als „Teufel“ zu deuten. Ein schönes Beispiel, wie ein Reisender
mit dieser Frage ringt, ist Willem Bosman, „Nawkeurige Beschryving van de Guinese Goud-Tand-en Slave-Kust […]“.
t´Utrecht 1704 (das Buch leichter zugänglich die englische Ausgabe „A New and Accurate Description of the Coast of Guinea
[…]“. London 1705 [Reprint Cambridge 2011], 228. Über Bosman [1672-?] vgl. Dietmar Henze, Enzyklopädie der Entdecker und
Erforscher der Erde. Bd. 1. Graz 1978 [Reprint Darmstadt 2011], 304f.). Bosman beschreibt, wie frühere Reisende und Händler
davon sprechen, die „Eingeborenen“ (also die Westafrikaner) wendeten sich in ihren Nöten an den Teufel. Dieser Auffassung
widerspricht er energisch, und verweist dazu auf seine eigene langjährige Erfahrung in Westafrika. Die Götter der
„Schwarzen“ sind für ihn zwar auch falsche Götter: aber Teufel sind sie keineswegs. Das ist nur ein erster Schritt
dieser Umwertung. Nur langsam und sukzessive im 18.-21. Jhdt. haben Ethnologie, Religionswissenschaft und Volkskunde
gelernt, die Kategorien der Beschreibung des „Fremden“ selbst zu hinterfragen, und dieser Prozess ist keineswegs
abgeschlossen. Dennoch ist es nicht verkehrt, von „Dämonen“ auch in nicht-europäischen Kontexten zu sprechen. Die
Funktionen dieser Numina ähneln sich eben doch erstaunlich, und ebenso der rituelle und narrative Umgang mit ihnen.
Natürlich überschneiden, überlappen sich die Kategorien, die hier ebenfalls zu bedenken wären, Geister, Naturwesen,
Ahnen, „arme Seelen“ (eine katholische Kategorie), Elementarwesen. Die evangelische Tradition hat seit Martin Luther
die Naturwesen, Kobolde, Wassermänner und -frauen und die Geister der populären Glaubenswelten stärker dämonisiert,
als es die katholische Tradition getan hatte. Die Wahrnehmung dieser Wesen ist eben auch noch in der frühen Neuzeit von
Rahmensystemen abhängig. Die Aufklärung hat manches verändert, oft aber auch weniger, als man im Stolz, auf etwas
„Vergangenes“ zurückzuschauen, gemeint hat. In den abendländischen Traditionen entwickeln sich Dämonologien vor
verschiedenen Hintergründen: biblischen, altkirchlich-christlichen, griechischen und römischen, aber auch solchen
der jüngeren europäischen Ethnien, keltischen, germanischen, slawischen, romanischen und anderen, die ihrerseits eine
lange Vorgeschichte in vorschriftlicher Zeit haben, antiken, mittelalterlichen und neuzeitlichen. Vor allem im 19.
Jahrhundert entdeckt die entstehende Volkskunde die Welt der Geister, Dämonen, Naturwesen als Forschungsgegenstand.
Leitgedanke ist ehemals das „survival“ (ein Begriff E. B. Tylors): man suchte im Volksglauben (wie man sagte) die
Überreste einer älteren, ungebrochenen, ungetrübten „Volkskultur“. Dabei spielten auch ethnische Klischees,
Stereotype eine Rolle, und die jüngere Forschung hat es sich auf die Fahnen geschrieben, diese zu überwinden.
In diesem puristischen Sinn hat sich das Konzept ehemals ganz eigenständiger europäischer „Volkstümer“ aufgelöst:
aber die Frage nach den mythologischen Imaginationen hat dadurch keineswegs an Faszination verloren. Wir
sehen sie eher in einem Netzwerk der Motivwanderungen, aber auch der Entanglements, bei denen die Frage
nach dem „Ursprünglichen“ oder dem „Woher“ und „Wohin“ sinnlos ist. Sie alle haben ihre Geschichte, können
sich aber auch in Literatur und Kunst fixieren, und werden dann Teil eines europäischen Gesamtimaginariums.
Mephisto ist eben nicht nur eine „deutsche“ Gestalt der Faustsage. Das Lexikon bietet natürlich auch allgemeinere
und theoretische Artikel („Aberglauben“), vor allem aber, als seinen Hauptinhalt, einzelne Studien zu den Figuren
der Dämonologie. Es hält die Wage zwischen einer kulturwissenschaftlichen Analyse und einer Präsentation, die auch
außerhalb dieses akademischen Diskurses verständlich ist.
Damit steht es in einer wissenschaftlichen Tradition, übertrifft diese aber doch vielfach. In der frühen Neuzeit waren es noch besonders die theologischen Dämonologen, die hexenkundlichen Autoren und auch die Zauberbücher selbst, die sich an Dämonenauflistungen versuchten.
Der angesehene, auch an Fürstenhöfen tätige Arzt Johannes Weyer (auch Wier u.ä., lateinisch Wierus, 1515/16-1588) publiziert 1577 eine lange kommentierte Dämonenliste unter dem Titel „De pseudomonarchia daemonum“. Diese war ein Anhang seines kritischen Hauptwerkes „De praestigiis daemonum“ in dessen fünfter Auflage (das Buch selbst zuerst Basel 1563, zahlreiche Ausgaben und bald auch Übersetzungen). Den Hexenglauben hält er weitgehend für wahnhaft und nimmt damit Fragestellungen der Psychiatrie vorweg: Sigmund Freud nannte das Buch daher eines der zehn wichtigsten Bücher der Menschheit. (Weyer schöpft dabei nach seinen eigenen Angaben aus einem „Liber officiorum spirituum, seu liber dictus Empto Salomonis, de principibus et regibus demoniorum“). Ein etwas älteres „Livre des Esperitz“ (Buch der Geister) ist handschriftlich erhalten (mittlerweile ediert nach dem Manuskript Cambridge, Trinity College O.8.29 aus dem 16. Jhdt.) ist ein weiteres, inhaltlich verwandtes Beispiel für das Genre der Dämonenlisten, das Weyer nicht erfunden, wohl aber in eine stabile Form gebracht hat. Die 69 Dämonen, die er vorstellt (eigentlich sollten es wohl 72 sein) sieht er in einer Art Monarchie, welche diejenige des Himmels nachahmt (daher „pseudomonarchia“). Das „Book of Oberon“ (Woodbury, Minn. 2015), eines der umfassendsten Beschwörungsbücher elisabethanischer Magie, enthält weiteres Material. (Der Titel stammt erst von den Herausgebern Daniel Harms, James R. Clark und Joseph E. Peterson: die Handschrift des 16. Jhdts. selbst hat ihre Titelseite verloren; sie liegt in der Folger Shakespeare Library in Washington, DC.) Vor allem war Weyer die dämonologische Hauptquelle für Reginald Scot, „The Discoverie of Witchcraft“ (zuerst 1584), ein zweites kritisches Buch zum Hexenglauben, das eine gewisse Bekanntheit dadurch erwarb, dass es auch magische Rezepte publizierte, die vorher nur handschriftlich greifbar waren. König Jakob I. wollte es deshalb gerne vernichten, was ihm nicht gelang. Berühmt wurde v.a. die weiter ergänzte Ausgabe London 1665, die zur Hauptquelle für die Dämonenlisten der englischen zeremoniellen Magie wurde. Die magischen Ritualtexte, die wir schon aus der Antike kennen, die aber ab dem Spätmittelalter immer länger werden, interagieren mit diesen Listen und übernehmen ihr Material aus diesen (wie auch umgekehrt). Die Geschichte derartiger Dämonenlisten könnte leicht bis in die Gegenwart fortgeschrieben werden, aber ihre okkulten oder gerade okkultismuskritischen Interessen führen doch in ganz andere Richtungen als Petzoldts Werk.
Ein Lexikon etwas anderer Art mag immerhin noch etwas ausführlicher genannt werden. Das bekannteste dämonologische Lexikon des 19. Jahrhunderts ist das „Dictionnaire infernal“ des Jacques Albin Simon Collin de Plancy (1793 oder 1794–1881). In seiner zweiten Auflage von 1826 lautete der noch recht barocke Titel (der hier einmal zitiert sein soll) „Dictionnaire infernal ou Bibliothèque Universelle, sur les êtres, les personnages, les livres, les faits et les choses, qui tiennent aux apparitions, à la magie, au commerce de l’enfer, aux divinations, aux sciences secrètes, aux grimoires, aux prodiges, aux erreurs et aux préjugés, aux traditions et aux contes populaires, aux superstitions diverses, et généralement à toutes les croyances merveilleuses, surprenantes, mystérieuses et surnaturelles“. Dieses monumentale Werk hat eine kuriose Geschichte: 1818 wurde es erstmals veröffentlicht. In dieser und der zweiten Auflage war der Tenor eher kirchen- und christentumskritisch, und viele Deutungen stehen in einer freidenkerischen Linie. Collin de Plancy wandte sich dann der Katholischen Kirche zu, und die späteren Auflagen sind zwar einerseits materialreicher, aber auch stärker aus einem katholischen Bewertungsdiskurs heraus geschrieben. Alle sechs Auflagen unterscheiden sich inhaltlich, auch wenn heute fast nur noch die letzte von 1863 rezipiert wird. Das Buch ist auch in der neomagischen Szene sehr bekannt und beliebt, obwohl der Autor kein praktizierender Magier gewesen ist. (Tatsächlich besaß die letzte Ausgabe eine kirchliche Imprimatur.) In wesentlichen Teilen ist es ein Dämonenlexikon. Eine englische Gesamtübersetzung in zwei Bänden (frühere waren stark gekürzt gewesen) erschien beim Verlag Abracax House 2015. Die französische Ausgabe von 1863 enthielt auch 550 sehr berühmte Holzschnitte, die für die englische Fassung digital nachbearbeitet wurden, und die sich an einer phantastischen Ikonographie der Dämonen versuchen, diese aber in die Fantasie des 19. Jhdts. übertragen (tatsächlich haben sich diese Ikonographien über die Jahrhunderte beträchtlich verändert). Hier werden zwar die Dämonen der magischen Tradition dargestellt, ergänzt um Einiges aus den globalen religiösen Kontexten, aber z. B. der Kontakt mit den Folklore Studies, also der Volkskunde war nur gering. Jüngere (v.a. englische) Zauberbücher u.ä. und die gesamte Okkultismusliteratur haben diese Bilder gerne übernommen, die damit Teil eines öffentlichen Imaginariums geworden sind.
Das sind nur Beispiele für die Traditionen, die in Sachen dämonologischer Listen zu bedenken sind. An populären Dämonenlexika ist kein Mangel: ein Beispiel wäre die „Encyclopedia of Spirits: The Ultimate Guide to the Magic of Fairies, Genies, Demons, Ghosts, Gods & Goddesses (Witchcraft & Spells)“, die Judika Illes 2009 herausgebracht hat. Im Internet gibt es unzählige solcher Listen. Sie haben aber keinen wissenschaftlichen Anspruch, und keine einzige könnte auch nur entfernt mit dem hier vorliegenden Werk konkurrieren (das gilt auch für die englischsprachigen Publikationen, von denen es naturgemäß noch mehr gibt als von deutschen). Jake Stratton-Kent, „Pandemonium. A Discordant Concordance. Diverse Spirit Catalogues” (West Yorkshire 2016) ist immerhin ein erster Versuch, die magisch-okkulten Listen systematisch zu vergleichen und im Vergleich abzudrucken. Das Werk ist aus der Sichtweise der Magiepraktizierenden geschrieben, womit daran erinnert werden mag, dass diese mittlerweile auch am akademischen Diskurs zur Sache selbst mitwirken. Das verändert die Forschung radikal, betrifft aber nur eine Facette des Geister- und Dämonen-Imaginariums.
Das hier vorliegende Werk ist natürlich in vielerlei Hinsicht etwas anderes. Es ist aus volkskundlicher (folkloristischer), also kulturwissenschaftlicher und aus erzählforschender Sicht geschrieben, integriert aber auch literaturwissenschaftliche und religionswissenschaftliche Materialien, solche aus der modernen Medienwelt und aus den magischen Traditionen. Eher vergleichbar ist das „Lexikon der Götter und Dämonen: Namen, Funktionen, Symbole/Attribute“, das Manfred Lurker herausbrachte (2. Aufl. Stuttgart 1989). Dieses holt weit aus, bietet aber nur sehr kurze Artikel, und ist in hohem Maße selektiv. Zum vorliegenden Werk kann es ebenfalls keine Konkurrenz sein, sowenig wie eines der anderen genannten. Nur für Einzelbereiche gibt es Lexika, die wissenschaftlichen Ansprüchen genügen, z. B. Karel van der Toorn, „Dictionary of deities and demons in the Bible” (DDD, Leiden [u.a.] 1995. 2. Aufl. 1999; eine Neubearbeitung ist in Vorbereitung). Aber ein Werk, das sowohl umfassend, kulturübergreifend (wenn auch noch nicht im vollen Sinn „global“: das kann ein Einzelner nicht leisten), kulturwissenschaftlich verantwortet, aus den Quellen selbst schöpfend und erarbeitet, den verschiedenen Diskursen zum Thema „Dämonen“ gleichermaßen verpflichtet ist, hat es bisher nicht gegeben. Bis jetzt: mit Leander Petzoldts „Dämonologischem Lexikon“ liegt nun (auch international) das erste umfassendere Nachschlagewerk vor, das diesen Namen tatsächlich verdient und die verschiedenen Interessen am Thema in einen wirklichen Kontakt bringt. Damit fasst es die Forschung vieler Generationen zusammen, bietet aber auch eine solide Basis für die Weiterarbeit. Diese wird einmal zu erklären haben, warum die Rede von den Dämonen ein Universale der conditio humana ist.
Damit steht es in einer wissenschaftlichen Tradition, übertrifft diese aber doch vielfach. In der frühen Neuzeit waren es noch besonders die theologischen Dämonologen, die hexenkundlichen Autoren und auch die Zauberbücher selbst, die sich an Dämonenauflistungen versuchten.
Der angesehene, auch an Fürstenhöfen tätige Arzt Johannes Weyer (auch Wier u.ä., lateinisch Wierus, 1515/16-1588) publiziert 1577 eine lange kommentierte Dämonenliste unter dem Titel „De pseudomonarchia daemonum“. Diese war ein Anhang seines kritischen Hauptwerkes „De praestigiis daemonum“ in dessen fünfter Auflage (das Buch selbst zuerst Basel 1563, zahlreiche Ausgaben und bald auch Übersetzungen). Den Hexenglauben hält er weitgehend für wahnhaft und nimmt damit Fragestellungen der Psychiatrie vorweg: Sigmund Freud nannte das Buch daher eines der zehn wichtigsten Bücher der Menschheit. (Weyer schöpft dabei nach seinen eigenen Angaben aus einem „Liber officiorum spirituum, seu liber dictus Empto Salomonis, de principibus et regibus demoniorum“). Ein etwas älteres „Livre des Esperitz“ (Buch der Geister) ist handschriftlich erhalten (mittlerweile ediert nach dem Manuskript Cambridge, Trinity College O.8.29 aus dem 16. Jhdt.) ist ein weiteres, inhaltlich verwandtes Beispiel für das Genre der Dämonenlisten, das Weyer nicht erfunden, wohl aber in eine stabile Form gebracht hat. Die 69 Dämonen, die er vorstellt (eigentlich sollten es wohl 72 sein) sieht er in einer Art Monarchie, welche diejenige des Himmels nachahmt (daher „pseudomonarchia“). Das „Book of Oberon“ (Woodbury, Minn. 2015), eines der umfassendsten Beschwörungsbücher elisabethanischer Magie, enthält weiteres Material. (Der Titel stammt erst von den Herausgebern Daniel Harms, James R. Clark und Joseph E. Peterson: die Handschrift des 16. Jhdts. selbst hat ihre Titelseite verloren; sie liegt in der Folger Shakespeare Library in Washington, DC.) Vor allem war Weyer die dämonologische Hauptquelle für Reginald Scot, „The Discoverie of Witchcraft“ (zuerst 1584), ein zweites kritisches Buch zum Hexenglauben, das eine gewisse Bekanntheit dadurch erwarb, dass es auch magische Rezepte publizierte, die vorher nur handschriftlich greifbar waren. König Jakob I. wollte es deshalb gerne vernichten, was ihm nicht gelang. Berühmt wurde v.a. die weiter ergänzte Ausgabe London 1665, die zur Hauptquelle für die Dämonenlisten der englischen zeremoniellen Magie wurde. Die magischen Ritualtexte, die wir schon aus der Antike kennen, die aber ab dem Spätmittelalter immer länger werden, interagieren mit diesen Listen und übernehmen ihr Material aus diesen (wie auch umgekehrt). Die Geschichte derartiger Dämonenlisten könnte leicht bis in die Gegenwart fortgeschrieben werden, aber ihre okkulten oder gerade okkultismuskritischen Interessen führen doch in ganz andere Richtungen als Petzoldts Werk.
Ein Lexikon etwas anderer Art mag immerhin noch etwas ausführlicher genannt werden. Das bekannteste dämonologische Lexikon des 19. Jahrhunderts ist das „Dictionnaire infernal“ des Jacques Albin Simon Collin de Plancy (1793 oder 1794–1881). In seiner zweiten Auflage von 1826 lautete der noch recht barocke Titel (der hier einmal zitiert sein soll) „Dictionnaire infernal ou Bibliothèque Universelle, sur les êtres, les personnages, les livres, les faits et les choses, qui tiennent aux apparitions, à la magie, au commerce de l’enfer, aux divinations, aux sciences secrètes, aux grimoires, aux prodiges, aux erreurs et aux préjugés, aux traditions et aux contes populaires, aux superstitions diverses, et généralement à toutes les croyances merveilleuses, surprenantes, mystérieuses et surnaturelles“. Dieses monumentale Werk hat eine kuriose Geschichte: 1818 wurde es erstmals veröffentlicht. In dieser und der zweiten Auflage war der Tenor eher kirchen- und christentumskritisch, und viele Deutungen stehen in einer freidenkerischen Linie. Collin de Plancy wandte sich dann der Katholischen Kirche zu, und die späteren Auflagen sind zwar einerseits materialreicher, aber auch stärker aus einem katholischen Bewertungsdiskurs heraus geschrieben. Alle sechs Auflagen unterscheiden sich inhaltlich, auch wenn heute fast nur noch die letzte von 1863 rezipiert wird. Das Buch ist auch in der neomagischen Szene sehr bekannt und beliebt, obwohl der Autor kein praktizierender Magier gewesen ist. (Tatsächlich besaß die letzte Ausgabe eine kirchliche Imprimatur.) In wesentlichen Teilen ist es ein Dämonenlexikon. Eine englische Gesamtübersetzung in zwei Bänden (frühere waren stark gekürzt gewesen) erschien beim Verlag Abracax House 2015. Die französische Ausgabe von 1863 enthielt auch 550 sehr berühmte Holzschnitte, die für die englische Fassung digital nachbearbeitet wurden, und die sich an einer phantastischen Ikonographie der Dämonen versuchen, diese aber in die Fantasie des 19. Jhdts. übertragen (tatsächlich haben sich diese Ikonographien über die Jahrhunderte beträchtlich verändert). Hier werden zwar die Dämonen der magischen Tradition dargestellt, ergänzt um Einiges aus den globalen religiösen Kontexten, aber z. B. der Kontakt mit den Folklore Studies, also der Volkskunde war nur gering. Jüngere (v.a. englische) Zauberbücher u.ä. und die gesamte Okkultismusliteratur haben diese Bilder gerne übernommen, die damit Teil eines öffentlichen Imaginariums geworden sind.
Das sind nur Beispiele für die Traditionen, die in Sachen dämonologischer Listen zu bedenken sind. An populären Dämonenlexika ist kein Mangel: ein Beispiel wäre die „Encyclopedia of Spirits: The Ultimate Guide to the Magic of Fairies, Genies, Demons, Ghosts, Gods & Goddesses (Witchcraft & Spells)“, die Judika Illes 2009 herausgebracht hat. Im Internet gibt es unzählige solcher Listen. Sie haben aber keinen wissenschaftlichen Anspruch, und keine einzige könnte auch nur entfernt mit dem hier vorliegenden Werk konkurrieren (das gilt auch für die englischsprachigen Publikationen, von denen es naturgemäß noch mehr gibt als von deutschen). Jake Stratton-Kent, „Pandemonium. A Discordant Concordance. Diverse Spirit Catalogues” (West Yorkshire 2016) ist immerhin ein erster Versuch, die magisch-okkulten Listen systematisch zu vergleichen und im Vergleich abzudrucken. Das Werk ist aus der Sichtweise der Magiepraktizierenden geschrieben, womit daran erinnert werden mag, dass diese mittlerweile auch am akademischen Diskurs zur Sache selbst mitwirken. Das verändert die Forschung radikal, betrifft aber nur eine Facette des Geister- und Dämonen-Imaginariums.
Das hier vorliegende Werk ist natürlich in vielerlei Hinsicht etwas anderes. Es ist aus volkskundlicher (folkloristischer), also kulturwissenschaftlicher und aus erzählforschender Sicht geschrieben, integriert aber auch literaturwissenschaftliche und religionswissenschaftliche Materialien, solche aus der modernen Medienwelt und aus den magischen Traditionen. Eher vergleichbar ist das „Lexikon der Götter und Dämonen: Namen, Funktionen, Symbole/Attribute“, das Manfred Lurker herausbrachte (2. Aufl. Stuttgart 1989). Dieses holt weit aus, bietet aber nur sehr kurze Artikel, und ist in hohem Maße selektiv. Zum vorliegenden Werk kann es ebenfalls keine Konkurrenz sein, sowenig wie eines der anderen genannten. Nur für Einzelbereiche gibt es Lexika, die wissenschaftlichen Ansprüchen genügen, z. B. Karel van der Toorn, „Dictionary of deities and demons in the Bible” (DDD, Leiden [u.a.] 1995. 2. Aufl. 1999; eine Neubearbeitung ist in Vorbereitung). Aber ein Werk, das sowohl umfassend, kulturübergreifend (wenn auch noch nicht im vollen Sinn „global“: das kann ein Einzelner nicht leisten), kulturwissenschaftlich verantwortet, aus den Quellen selbst schöpfend und erarbeitet, den verschiedenen Diskursen zum Thema „Dämonen“ gleichermaßen verpflichtet ist, hat es bisher nicht gegeben. Bis jetzt: mit Leander Petzoldts „Dämonologischem Lexikon“ liegt nun (auch international) das erste umfassendere Nachschlagewerk vor, das diesen Namen tatsächlich verdient und die verschiedenen Interessen am Thema in einen wirklichen Kontakt bringt. Damit fasst es die Forschung vieler Generationen zusammen, bietet aber auch eine solide Basis für die Weiterarbeit. Diese wird einmal zu erklären haben, warum die Rede von den Dämonen ein Universale der conditio humana ist.
Einführung in die Dämonologie und in dieses Online-Lexikon von Prof. Dr. Leander Petzoldt
Der Glaube an Dämonen und Elementargeister ist bereits in der Antike, aber auch noch im 16., 17. und 18. Jahrhundert mindestens ebenso durch die zeitgenössische gelehrte Literatur verbreitet worden wie durch die Volkserzählung, das heißt durch die Erlebnisberichte von Betroffenen. Die Volksglaubensforschung geht von der subjektiven Glaubwürdigkeit solcher Berichte aus. Der Volksglaube und die Volkssage sind damit neben den naturwissenschaftlich-philosophischen Schriften von der Renaissance bis ins 18. Jahrhundert die wichtigste Quelle für die Vorstellungen von Dämonen und Elementargeistern.
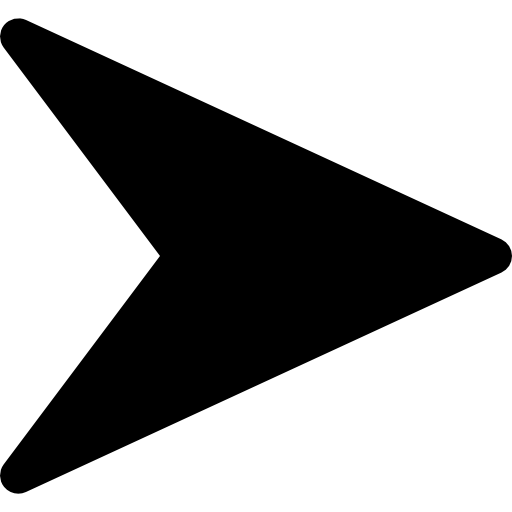
Die Bedeutung des Wortes Dämon

Holzschnitt Meerfräulein von 1556. Gemeinfrei,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7556436
Die Beutung des bzw. der Dämonen und des Wortes selbst ist in stetem Wandel begriffen, denn in der ursprünglichen Bedeutung des altgriechischen δαίμων daímōn bezeichnet es einen „Geist“ (lateinisch spiritus) oder eine Schicksalsmacht (δαιμόνιον daimónion) bzw. vor allem einen Vermittler zwischen den Menschen und dem Göttlichen. Die Grundbedeutung des Wortes „Daimon“ (griech. daiesthai) weist außerdem auf den Vorgang des Teilens, Zuteilens hin, und meint damit das Schicksal, das bei der Geburt jedem Wesen zugeteilt wird. Der Glaube an Dämonen trägt zum Verständnis dieser Welt bei, er erklärt die Welt und macht menschliche Erfahrungen verstehbar. In diesem Sinne bezeichnet etwa Sigmund Freud in Totem und Tabu (1913) die ‚Erfindung’ der Geister und Dämonen als die erste theoretische Leistung des Menschen.
Bis ins 18. Jahrhundert für unbezweifelbare Realität gehalten, umfasst dieser Dämonenbegriff zunächst auch die im vorislamischen Iran entstandenen Dämonenvorstellungen und die Natur- und Elementargeister des Volksglaubens. Die Genese der Vorstellung von Natur- und Elementargeistern kann als Personifikation einzelner Naturerscheinungen und Konkretisierung meteorologischer Vorgänge ebenso wie psychischer Ängste gedeutet werden. Zwar nicht der Etymologie des Dämonenbegriffs folgend, jedoch psychologisch stringent, stehen die Dämonenvorstellungen seit frühester Zeit mit der populären Tradition in Verbindung. Dämonen sind Glaubensgestalten und Erzählgestalten zugleich, Phänomene des Volksglaubens, die sich in der Volkserzählung konkretisieren.
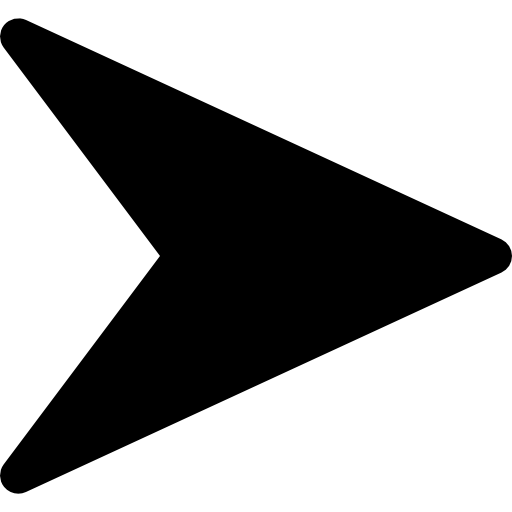
Die Namen der Dämonen
Freilich entsteht bereits das erste Problem mit der sprachlichen und inhaltlichen Differenzierung der Bezeichnungen: Dämonen, Geister,
Gespenster, Unholden, Jenseitige, usw. Eine Abgrenzung erscheint hier fast unmöglich. Bereits in den ältesten (lat.) Quellen, in denen
dämonische Wesen erwähnt werden, findet sich eine Vielzahl von Bezeichnungen: daemonium, faunus, pilosus, silvanus, lamia, larva, genius,
spiritus, monstrum usw. Die interpretatio christiana ersetzt häufig die Bezeichnung daemonium durch ‚tiufel’, ‚dyabolus’ oder ‚malignus spiritus’.
Eines der schwierigsten Probleme in der gelehrten und populären Dämonologie ist daher die Namengebung dämonischer Wesen. Ein Dämon, dessen Namen man kennt, ist weniger furchterregend als das unbekannte, numinose (göttlich-geheimnisvolle), nicht-geheure Wesen, denn mit der Kenntnis des Namens verschafft man sich Macht über den Dämon.
Nur selten sind Namen so eindeutig wie die Bezeichnungen Riese oder Zwerg, aber schon hier wird es schwierig, wenn wir die „Menschenriesen“, wie etwa „Haymon“, von den „Naturriesen“ wie „Thyrsus“ unterscheiden, wobei die Etymologie Thyrsus ja letztlich auf anord. Thyrsa, finn. Tursas, ahd. Durisis, > Thyrse zurückgeht, was sozusagen die Gattungsbezeichnung ist. Im angelsächsischen Beowulf wird „Grendel“ als „thyrs“ bezeichnet.

In den frühen antiken bzw. lateinischen Handschriften versuchen die deutschen Autoren autochthone (einheimische, hier eigene, neue deutsche) Begriffe anhand des Lateinischen auszudrücken. Im so genannten Corrector, einem Penitentiale (Bußbuch) des Burchard von Worms (10./11. Jahrhundert), finden wir (nach dem Vorbild von Plinius und Petronius Arbiter) den ersten deutschen Beleg für die Vorstellung vom Werwolf. Es heißt dort (Cap. 139) „creditisti […] ut in lupum transformari possit, quod vulgaris stultitia werwolf vocat“. Weiterhin bringt er Belege für „Wiedergänger“ (Revenants), dämonisierte Tote und Hexen, wobei er letztere im lateinischen Text als „holda“ bezeichnet, während die Lex Salica (um 500) und Regino von Prüm die lateinische Bezeichnung „striga“ bevorzugen. Bei Burchard vom Worms finden wir jedoch auch noch die antiken Faunen und Satyrn, die Larvae und Lamia. In einer Handschrift hat der Schreiber des besseren Verständnisses wegen über das Lemma „Larva“ die deutsche Bezeichnung „scrato“ geschrieben, damit drängt sich die Notwendigkeit auf, die Termini für dämonische Gestalten aus ihrem Kontext zu erklären und darüber hinaus ihre Stellung innerhalb eines mythologischen Systems zu beschreiben. Die Polysemie (Vieldeutigkeit) der Termini (Begriffe) ist schon in der Antike überaus verwirrend; in der frühen Neuzeit, in der wir einen latenten Verfalls- und Kontaminationsprozess der Namengebung beobachten können, wird die Spezifik einzelner dämonischer Gestalten immer undeutlicher. Oft ist die Bezeichnungen dämonischer Wesenheiten von Ort zu Ort verschieden, obwohl es sich phänomenologisch (vom Aussehen her) und typologisch um die gleichen Gestalten handelt. Freilich hat eine solche Typologie, wie sie schon Trithemius und andere versucht haben, ihre Grenzen. Vor allem wandelt sich des Wesen vieler Dämonen über die Jahrhunderter hin: die Wandlungen des „Nichus“, von einem Flussgott über einer krokodilartige Bestie zur Nixe (ähnlich dem Bilwis) ist ein treffendes Beispiel.
Es gibt zudem Kollektivdämonen, wie Zwerge, zugleich aber auch Solitärgestalten wie Alberich (Oberon). Der Aufhocker (niederdeutsch: Huckup) ist ein nomen agentis, das heißt der Name drückt seine Tätigkeit aus: ein dämonisches Wesen springt einem Wanderer auf den Rücken und bedrängt ihn bis zum Fieberwahn. Dieses Wesen aber kann als Alp/Alb, Totengeist, Hexe, Werwolf, Feuermann, Hehmann, usw. beschrieben werden. Trotzdem ist der Aufhocker zunächst prinzipiell ein Dämon sui generis, als eigene Gattung.
Die in den Lexika des 15. und 16. Jahrhunderts überlieferten Termini aus dem Bereich der Magie und Divination haben eine deutlich narrative Funktion, wie Claude Lecouteux in Das Reich der Nachtdämonen. Angst und Aberglaube im Mittelalter (2001) schreibt, da sie als „Hilfsmittel zur Erlernung des Lateinischen oder zum Umgang mit ihm gedacht sind“. Sie „kodifizieren den Volksmund […] und erheben einige wenige deutsche Wörter zu allumfassenden Begriffen“. Dasselbe gilt auch für die dämonischen Wesenheiten und die sich darauf beziehenden Volkserzählungen.
Bevorzugt werden Drache, Basilisk, Greif, Salamander, Pelikan und Phönix, da sie nicht nur in den religiösen Schriften als Basis für homiletische (die Bibel auslegende Predigttexte) Auslegungen dienen, sondern auch in der Unterhaltungsliteratur der Zeit beliebte Mirabilia (Sammlung von Wundern) verkörpern. Hinzu kommt ein überliefertes Grundwissen über Fabelwesen, das auf der Bibel, dem Physiologus und den Kommentaren zu Vergil und Ovid beruht. Auf diese Weise wird die Bezeichnung „Pygmäen“ zum Synonym für „Zwerge“, wie es noch bei Paracelsus der Fall ist. Sie bezeichnet in der gelehrten Literatur, gegen Ende des 15. Jahrhunderts (so Petrus Dasypodius) keineswegs die „echten“ Pygmäen; dagegen kommt etwa im gleichen Zeitraum die Bezeichnung „erdmennly“ für Zwerge bzw. Erdgeister auf. Da die Autoren der gelehrten Lexika vor allem bemüht waren, durch die Tradition geheiligte Begriffe (denen „auctoritas“, also Autorität zukam) weiterzugeben, finden sich bei ihnen viele Inhalte populärer Glaubensvorstellungen, seien sie von anderen Lexikographen übernommen oder direkt aus dem Volksglauben geschöpft. Prinzipiell ist zu sagen, dass der übergeordnete Begriff „Dämonen“ sehr vielschichtig und polyvalent ist und die Abgrenzung gegenüber Geistern, Gespenstern und ähnlichen Begriffen bzw. Wesenheiten fast unmöglich ist, da sie oft synonym gebraucht werden.
Eines der schwierigsten Probleme in der gelehrten und populären Dämonologie ist daher die Namengebung dämonischer Wesen. Ein Dämon, dessen Namen man kennt, ist weniger furchterregend als das unbekannte, numinose (göttlich-geheimnisvolle), nicht-geheure Wesen, denn mit der Kenntnis des Namens verschafft man sich Macht über den Dämon.
Nur selten sind Namen so eindeutig wie die Bezeichnungen Riese oder Zwerg, aber schon hier wird es schwierig, wenn wir die „Menschenriesen“, wie etwa „Haymon“, von den „Naturriesen“ wie „Thyrsus“ unterscheiden, wobei die Etymologie Thyrsus ja letztlich auf anord. Thyrsa, finn. Tursas, ahd. Durisis, > Thyrse zurückgeht, was sozusagen die Gattungsbezeichnung ist. Im angelsächsischen Beowulf wird „Grendel“ als „thyrs“ bezeichnet.

Der Werwolf von Onolzbach anno 1685 Georg Jakob Schneider, Nürnberg fec.
In den frühen antiken bzw. lateinischen Handschriften versuchen die deutschen Autoren autochthone (einheimische, hier eigene, neue deutsche) Begriffe anhand des Lateinischen auszudrücken. Im so genannten Corrector, einem Penitentiale (Bußbuch) des Burchard von Worms (10./11. Jahrhundert), finden wir (nach dem Vorbild von Plinius und Petronius Arbiter) den ersten deutschen Beleg für die Vorstellung vom Werwolf. Es heißt dort (Cap. 139) „creditisti […] ut in lupum transformari possit, quod vulgaris stultitia werwolf vocat“. Weiterhin bringt er Belege für „Wiedergänger“ (Revenants), dämonisierte Tote und Hexen, wobei er letztere im lateinischen Text als „holda“ bezeichnet, während die Lex Salica (um 500) und Regino von Prüm die lateinische Bezeichnung „striga“ bevorzugen. Bei Burchard vom Worms finden wir jedoch auch noch die antiken Faunen und Satyrn, die Larvae und Lamia. In einer Handschrift hat der Schreiber des besseren Verständnisses wegen über das Lemma „Larva“ die deutsche Bezeichnung „scrato“ geschrieben, damit drängt sich die Notwendigkeit auf, die Termini für dämonische Gestalten aus ihrem Kontext zu erklären und darüber hinaus ihre Stellung innerhalb eines mythologischen Systems zu beschreiben. Die Polysemie (Vieldeutigkeit) der Termini (Begriffe) ist schon in der Antike überaus verwirrend; in der frühen Neuzeit, in der wir einen latenten Verfalls- und Kontaminationsprozess der Namengebung beobachten können, wird die Spezifik einzelner dämonischer Gestalten immer undeutlicher. Oft ist die Bezeichnungen dämonischer Wesenheiten von Ort zu Ort verschieden, obwohl es sich phänomenologisch (vom Aussehen her) und typologisch um die gleichen Gestalten handelt. Freilich hat eine solche Typologie, wie sie schon Trithemius und andere versucht haben, ihre Grenzen. Vor allem wandelt sich des Wesen vieler Dämonen über die Jahrhunderter hin: die Wandlungen des „Nichus“, von einem Flussgott über einer krokodilartige Bestie zur Nixe (ähnlich dem Bilwis) ist ein treffendes Beispiel.
Es gibt zudem Kollektivdämonen, wie Zwerge, zugleich aber auch Solitärgestalten wie Alberich (Oberon). Der Aufhocker (niederdeutsch: Huckup) ist ein nomen agentis, das heißt der Name drückt seine Tätigkeit aus: ein dämonisches Wesen springt einem Wanderer auf den Rücken und bedrängt ihn bis zum Fieberwahn. Dieses Wesen aber kann als Alp/Alb, Totengeist, Hexe, Werwolf, Feuermann, Hehmann, usw. beschrieben werden. Trotzdem ist der Aufhocker zunächst prinzipiell ein Dämon sui generis, als eigene Gattung.
Die in den Lexika des 15. und 16. Jahrhunderts überlieferten Termini aus dem Bereich der Magie und Divination haben eine deutlich narrative Funktion, wie Claude Lecouteux in Das Reich der Nachtdämonen. Angst und Aberglaube im Mittelalter (2001) schreibt, da sie als „Hilfsmittel zur Erlernung des Lateinischen oder zum Umgang mit ihm gedacht sind“. Sie „kodifizieren den Volksmund […] und erheben einige wenige deutsche Wörter zu allumfassenden Begriffen“. Dasselbe gilt auch für die dämonischen Wesenheiten und die sich darauf beziehenden Volkserzählungen.
Bevorzugt werden Drache, Basilisk, Greif, Salamander, Pelikan und Phönix, da sie nicht nur in den religiösen Schriften als Basis für homiletische (die Bibel auslegende Predigttexte) Auslegungen dienen, sondern auch in der Unterhaltungsliteratur der Zeit beliebte Mirabilia (Sammlung von Wundern) verkörpern. Hinzu kommt ein überliefertes Grundwissen über Fabelwesen, das auf der Bibel, dem Physiologus und den Kommentaren zu Vergil und Ovid beruht. Auf diese Weise wird die Bezeichnung „Pygmäen“ zum Synonym für „Zwerge“, wie es noch bei Paracelsus der Fall ist. Sie bezeichnet in der gelehrten Literatur, gegen Ende des 15. Jahrhunderts (so Petrus Dasypodius) keineswegs die „echten“ Pygmäen; dagegen kommt etwa im gleichen Zeitraum die Bezeichnung „erdmennly“ für Zwerge bzw. Erdgeister auf. Da die Autoren der gelehrten Lexika vor allem bemüht waren, durch die Tradition geheiligte Begriffe (denen „auctoritas“, also Autorität zukam) weiterzugeben, finden sich bei ihnen viele Inhalte populärer Glaubensvorstellungen, seien sie von anderen Lexikographen übernommen oder direkt aus dem Volksglauben geschöpft. Prinzipiell ist zu sagen, dass der übergeordnete Begriff „Dämonen“ sehr vielschichtig und polyvalent ist und die Abgrenzung gegenüber Geistern, Gespenstern und ähnlichen Begriffen bzw. Wesenheiten fast unmöglich ist, da sie oft synonym gebraucht werden.
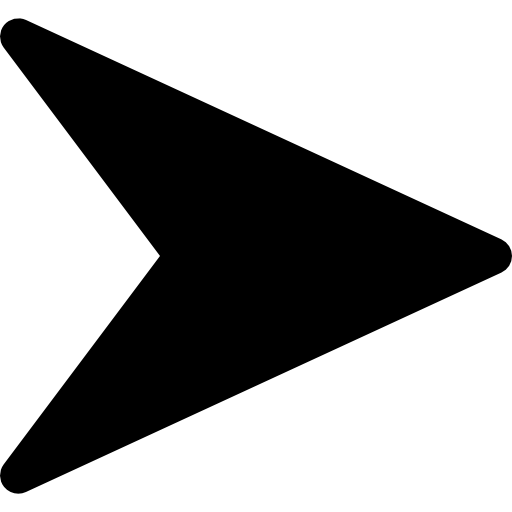
Arten von Dämonen
Naturdämonen finden sich hier neben dämonisierten historischen Persönlichkeiten, Gottheiten und Totengeistern.
Für die Aufnahme in das Lexikon spielt weniger ihre geographische Herkunft, als ihr Auftreten im europäischen Kulturraum eine Rolle.
Zu den ältesten Vorstellungen gehören zweifellos die von den Totengeistern, die sich den Lebenden zeigen, und deren Erscheinen nicht ohne
Folgen bleibt. Insgesamt könnte man dieses Kapitel der Volkssage unter den Titel stellen „Zur Frühgeschichte der Angst“, denn wie der
archaische Totenkult aus der Angst vor den Toten entstanden ist, spiegeln die Sagen der Ambivalenz der Einstellung des Menschen zu
seinen Toten als verehrungswürdige Ahnen und bösartige Dämonen und Wiedergänger wider. Doch nicht nur in den Totensagen wird die
Angst des Menschen manifest. Die Fülle und der ‚Artenreichtum’ der Dämonen allein in unserem Kulturkreis macht eine
Systematisierung fast unmöglich. Seit dem 15. Jahrhundert hat man immer wieder versucht, Dämonologien zu entwerfen und die
Dämonenwelt in ein System zu bringen.
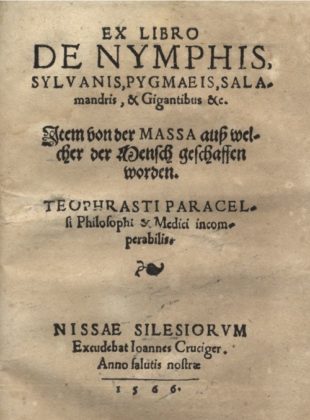
Der alemannische Naturforscher Theophrastus von Hohenheim genannt Paracelsus (1493-1541) schreibt in seinem 1566 posthum erschienenen Liber de nymphis, sylphis, pygmaeis et alamandris et de caeteris spiritibus also in seinem „Büchlein über die Nymphen, Sylphen, Pygmäen, Salamander und die übrigen Elementargeister“, ein jeglicher Mensch habe die Erkenntnis seiner selbst, aber im Menschen sei auch ein Licht, „ausserthalb dem Liecht so in der Natur geboren ist: Dasselbig ist das Liecht dordurch der Mensch übernatürlich Dinge erfahrt, lehrnt und ergründt“. In seinem Werk stellt sich Paracelsus die Aufgabe „die Geschöff ausserthalb des Liechts der Natur“ zu beschreiben; für ihn sind alle diese Dämonen und Geister von unbezweifelbarer Realität, er bezeichnet die Elementargeister sogar als „Geistmenschen“ (Tract. I. Cap.I). wie wohl sie nicht aus Adam geboren sind. Sie sind sozusagen von menschlicher Natur, besitzen aber keine Seele: „also sind sie Menschen vond Leuth, sterben mit dem Viech, wandeln mit den Geistern, essen und trinken mit den Menschen“ (p.15). „Ihr Wohnung sind viererley, das ist nach dem Vier Elementen. Eine im Wasser, eine in Luft, Eine in der Erden, Eine im Feuer. Die im Wasser sind Nymphen, die im Luft sind Sylphen, die in der Erden sind Pygmaei, die im Feuer Salamandrae.“
Was Paracelsus hier von den Elementargeistern schreibt, kennzeichnet den Endstand einer Entwicklung der Dämonenvorstellung, die ihre Wurzeln in der griechischen Naturphilosophie und im Neuplatononismus hat und, dies sei vorweg betont, die sich als Ergebnis vorwissenschaftlicher Spekulation bezeichnen lässt, einer Gelehrtenkultur, die im Wesentlichen neben und außerhalb der Volkskultur anzusiedeln ist.
Die mittelalterliche Dämonenlehre mit ihrer Einteilung der „Elementargeister“ nach den vier Elementen Wasser, Feuer, Erde und Luft verspricht eine scheinbar logische Systematik. Aber ihre Logik entstammt den Spekulationen der Naturphilosophen des 15. und 16. Jahrhunderts und nicht zuletzt der naturromantischen Dichtung des 19. Jahrhunderts. Die Sylphen und Najaden, Undinen und Nymphen waren niemals Gestalten des Volksglaubens, sie waren Schöpfungen der vorwissenschaftlichen Naturphilosophie, die ihr Material den spätantiken Dämonenlehren verdankte.
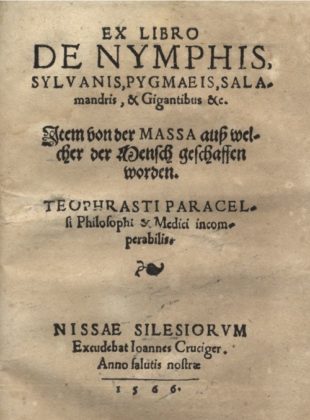
Der alemannische Naturforscher Theophrastus von Hohenheim genannt Paracelsus (1493-1541) schreibt in seinem 1566 posthum erschienenen Liber de nymphis, sylphis, pygmaeis et alamandris et de caeteris spiritibus also in seinem „Büchlein über die Nymphen, Sylphen, Pygmäen, Salamander und die übrigen Elementargeister“, ein jeglicher Mensch habe die Erkenntnis seiner selbst, aber im Menschen sei auch ein Licht, „ausserthalb dem Liecht so in der Natur geboren ist: Dasselbig ist das Liecht dordurch der Mensch übernatürlich Dinge erfahrt, lehrnt und ergründt“. In seinem Werk stellt sich Paracelsus die Aufgabe „die Geschöff ausserthalb des Liechts der Natur“ zu beschreiben; für ihn sind alle diese Dämonen und Geister von unbezweifelbarer Realität, er bezeichnet die Elementargeister sogar als „Geistmenschen“ (Tract. I. Cap.I). wie wohl sie nicht aus Adam geboren sind. Sie sind sozusagen von menschlicher Natur, besitzen aber keine Seele: „also sind sie Menschen vond Leuth, sterben mit dem Viech, wandeln mit den Geistern, essen und trinken mit den Menschen“ (p.15). „Ihr Wohnung sind viererley, das ist nach dem Vier Elementen. Eine im Wasser, eine in Luft, Eine in der Erden, Eine im Feuer. Die im Wasser sind Nymphen, die im Luft sind Sylphen, die in der Erden sind Pygmaei, die im Feuer Salamandrae.“
Was Paracelsus hier von den Elementargeistern schreibt, kennzeichnet den Endstand einer Entwicklung der Dämonenvorstellung, die ihre Wurzeln in der griechischen Naturphilosophie und im Neuplatononismus hat und, dies sei vorweg betont, die sich als Ergebnis vorwissenschaftlicher Spekulation bezeichnen lässt, einer Gelehrtenkultur, die im Wesentlichen neben und außerhalb der Volkskultur anzusiedeln ist.
Die mittelalterliche Dämonenlehre mit ihrer Einteilung der „Elementargeister“ nach den vier Elementen Wasser, Feuer, Erde und Luft verspricht eine scheinbar logische Systematik. Aber ihre Logik entstammt den Spekulationen der Naturphilosophen des 15. und 16. Jahrhunderts und nicht zuletzt der naturromantischen Dichtung des 19. Jahrhunderts. Die Sylphen und Najaden, Undinen und Nymphen waren niemals Gestalten des Volksglaubens, sie waren Schöpfungen der vorwissenschaftlichen Naturphilosophie, die ihr Material den spätantiken Dämonenlehren verdankte.
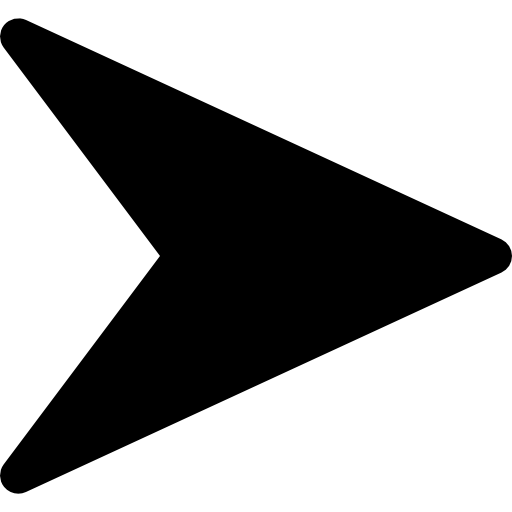
Diabolisierung der Dämonen
Dieser Vorgang der Diabolisierung setzt schon früh ein und wird, vor allem durch Luther, im 16. Jahrhundert,
konsequent zu Ende geführt. Durch das Christentum wird der spätantiken und mittelalterlichen Dämonologie die
biblische Überlieferung vom Sturz der abtrünnigen Engel hinzugefügt, eine Vorstellung, die bereits in der jüdischen Überlieferung
der späthellenistischen Zeit verbreitet ist, nach der die Dämonen Abkömmlinge jener gefallenen Engel sind, wie es Gen. 6, 1-4 heißt,
die sich mit den Töchtern der Menschen vermischten.


Ausschnitt aus dem Holzschnitt zu Dante Alighieri, La Divina Commedia /
Die Göttliche Komödie, "Inferno", Florence: Nicolaus Laurentii, Alamanus 1481.
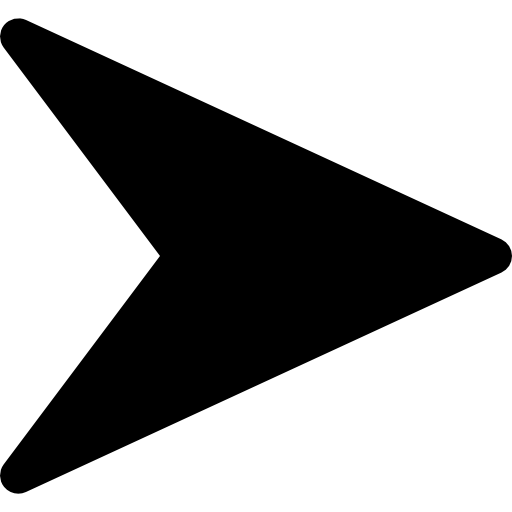
Dämonologie des Agrippa von Nettesheim

Kupferstich-Portrait des Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486-1535) aus André Thevets Les Vrais
pourtraits et vies des hommes illustres grecz, latins et payens von 1584
Eine differenziertere Dämonenlehre finden wir bei Agrippa von Nettesheim (1486-1535). Er versucht in seiner Occulta Philospophia (1531), das Christentum mit den Dämonen der Antike zu versöhnen und entwickelt seine Dämonologie:
„Endlich spricht man von Tag-, Nacht- und Mittagsgeistern sowie von Wald-, Berg, Feld- und Hausgeistern. Daher die Silvanen, Faunen, Satyrn, Pane, Nymphen, Najaden, Nereiden, Dryaden“ (...) „Einige dieser Dämonen verlieben sich in Frauenzimmer, andere in Knaben, noch andere haben eine Freude an verschiedenen Haus- oder Waldtieren. Einige wohnen in Wäldern und Hainen, andere bei Quellen und auf Wiesen. So bewohnen die Faune und Lemuren die Felder, die Najaden die Quellen, die Potamiden die Flüsse, die Nymphen die Seen und sonstigen Gewässer, die Oreaden die Berge, die Humeaden die Wiesen, die Dryaden und Hamadryaden die Wälder, welche auch die Satyre und Sylvanen bewohnen und wo sie sich an den Bäumen und Rasenplätzen erfreuen, wie die Nepeten und Agapeten an den Blumen, die Dodonen an den Eichen, die Paleen und Fenilien an Futter und Feldbau.“
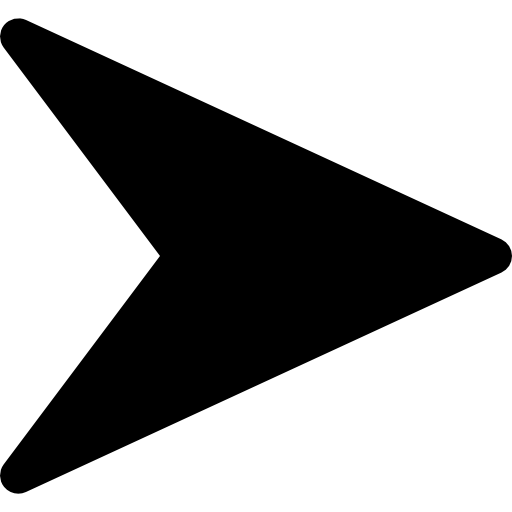
Trithemius’ Dämonenlehre

Kupferstich Johannes Trithemius (eigtl. Johannes Heidenberg oder Johannes Zeller, auch Johannes von Trittenheim, Johannes Tritheim) "IOANNES TRITHEMIUS"
(1462 - 1516 ), 16. Jahrhundert.
Johannes Trithemius, der Abt von Sponheim (1462-1516) etwa spekuliert in seiner Chronologia mystica über die Dynastien der Geister. Auch in seinem Buch von den acht Fragen (Liber Octo questionoum, 1515) beschäftigt er sich mit solchen Themen und stellt eine Systematik der Geister auf. Freilich sieht der gelehrte Abt in den antiken Dämonen nur noch Ausgeburten des Teufels.
Trithemius kennt nun mehrere Geschlechter von Geistern, die er zunächst den Elementen zuordnet:
„Es seind viel Geschlecht der bösen Geister, haben auch unter einander etliche unterschiedliche Grad und Staffel, nach Gelegenheit der Örter, in welche sie am Anfang ihres Falles erstlich verstoßen worden sind, Zum ersten, so ist ein Geschlecht der Teufel, das heißt man Igneum, das seind feurige Teufel; die wohnen in der obersten Luft, kommen nimmermehr vor dem jüngsten Tag herab auf Erden, sondern sie bleiben stetig in der Region des Mondes, haben auch gar keine Gemeinschaft mit den Menschen, die auf Erden wohnen […] Das ander Geschlecht der Teufel heißt Aereum, seind die bösen Geister, die da in der Luft unter dem Himmel, nahe bei uns umher wohnen und fahren. Diese könnten wohl herab auf die Erde kommen, und so sie von der groben Luft einen Leib an sich genommen haben, erscheinen sie zu Zeiten den Menschen sichtbarlich. Diese Geister betrüben aus Verhängnis Gottes oftmals die Luft, machen donnern und Ungewitter, seind allzugleich miteinander zu Verderben der Menschen geneigt und verbunden. Sie haben gleich wie die Menschen ihre Affektion und Beweglichkeit, sonderlich in Hoffahrt und Neid, werden ohn Unterlaß mit Anffechtung getrieben; haben nit einen steten Körper, bleiben auch nit immerzu an einem Ort. Sie haben auch nit alle eine gleiche [...] Das dritt Geschlecht der bösen Geister nenn wir die irdischen Teufel, welche, als wir in keinen Zweifel setzen, aus dem Himmel auf das Erdreich für ihre Verschuldung gestürzt worden sind ... Von diesen Teufeln und bösen Geistern wohnt ein Teil in den Hölzern und Wäldern, die tun den Jägern viel Schalkheit; etliche wohnen auf dem freien Felde, die bei Nacht die Leut, so über Feld gehen, irrig machen und abwegs führen; ein Teil wohnt in heimlichen, verborgenen Winkeln und Höhlen, und etlich, die da nit so gar wütend und tobend seind als die andern, die wohnen gern um die Menschen, doch in einem verborgenen dunkeln Winkel. Sie haben nit all einen, sondern mancherlei Sinn, Willen und Anmutung, denn es ist immer ein böser denn der andere [...] Das viert Geschlecht und Art der Teufel heißt man Aquaticum, das ist darum, daß sie gern um die Wasser wohnen, erweckt auf dem Meer allerlei Ungewitter, versenkt die Schiff in die Tiefe, ertränkt viel Menschen [...] Darüberhinaus nennt er als fünftes Geschlecht der Geister die Unterirdischen,die in „Höhlen und Löchern und in den heimlichen Winkeln auf den Bergenwohnen“. Sie sind seiner Meinung nach die allerbösesten, stellen den Leuten nach, die unter der Erde arbeiten, den Brunnengräbern und vor allem den Erzknappen.
Es wird deutlich, dass nur weniges, was Trithemius über die Dämonen sagt, in den mittelalterlichen Volksglauben eingegangen ist. Zu sehr ist er der antiken und neuplatonischen Gelehrtentradition verpflichtet, die er nur wenig modifiziert. Nur die Beschreibung der Dämonen, die „in den Hölzern und Wäldern“ wohnen, erinnert an die Vielzahl der Waldgeister, Moosweibchen, Fänggen und Wildleute der volkstümlichen Überlieferung.
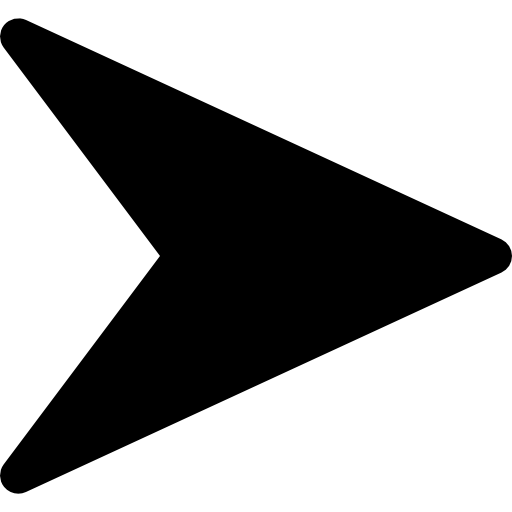
Paracelsus’ Dämonenlehre

Kupferstich Philip Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus, 1645
Einer der Hauptvertreter war Theophrastus Paracelsus (1493-1541), der in seinem bereits erwähnten Liber de nymphis, sylphis, pygmaeis et salamandribus (1566) eine Hierarchie der Elementargeister aufstellt und gemäß seiner Vorstellungen von der Kosmogonie lehrte, dass alle Dinge des Mikrokosmos ihre Entsprechungen im Makrokosmos haben. Er erklärt auch das Begehren der Dämonen nach menschlichen Ehepartnern. Da sie keine Seele besitzen, versuchen sie durch die Verbindung mit den Menschen an dessen Transzendenz teilzunehmen. Von den Wassergeistern schreibt er:
„Nur aber, Menschen sinds, aber allein in tierischer Art, ohne Seel. Nun folgt aus dem, dass sie zu Menschen verheiratet werden, also daß eine Wasserfrau einen Mann aus Adam nimmt, und hält mit ihm Haus und gebiert. Von den Kindern wisset, dass solch Gebären dem Mann nachschlägt, drum daß der Vater ein Mensch ist aus Adam, darum wird dem Kind eine Seel eingegossen und es wird gleich einem rechten Menschen, der eine Seel hat.“
Während die Elementargeister bei Paracelsus noch als eine Art Menschen, jedoch ohne Seele verstanden werden, geht Luther einen Schritt weiter und vollendet die interpretatio christiana, die Umdeutung heidnischer Bräuche in einen christlichen Kontext, indem er alle diese dämonischen Wesen schlechtweg als Verwandlungsgestalten des Teufels erklärt. Freilich hat sich diese Interpretation im Volksglauben nur teilweise durchgesetzt. Und viele der hier beschriebenen Gestalten bewahren trotz aller Diabolisierungstendenzen ihr archaisches Wesen bis auf unsere Tage.
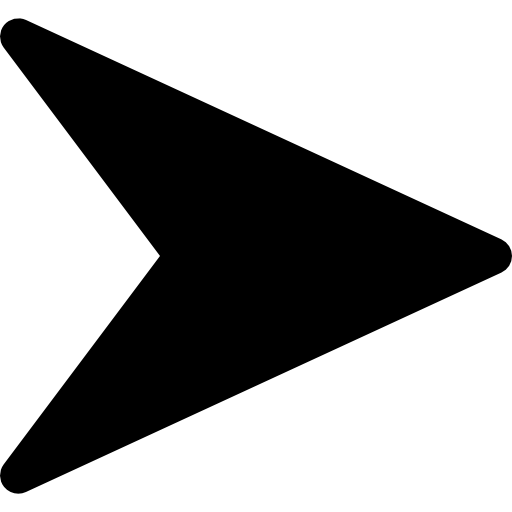
Vegetationsgottheiten: Die Korndämonen
Eine frühe Stufe dieser Glaubensvorstellung sind in der Verkörperung bzw. Dämonisierung archaischer Vegetationsgottheiten zu sehen,
die Wilhelm Mannhardt mit dem Sammelbegriff „Korndämonen“ bezeichnete, so in seinen Werken Die Korndämonen. Beitrag zur germanischen
Sittenkunde (Berlin 1868) und Wald- und Feldkulte (2 Teile, Berlin 1875/1877).
Es sind Vegetationsdämonen, die sich im Kornfeld (aber auch in allen anderen Pflanzungen wie Flachs, Bohnen, Mohn, Hopfen usw.) aufhalten. Sie treten in menschlicher (Kornmuhme), als auch in tierischer (Roggenwolf) Gestalt auf. Sie können sowohl männlichen, als auch weiblichen Geschlechts sein. Zweifellos treten Korn- bzw. Vegetationsdämonen bei allen agrarisch orientierten Völkern auf. In Jägerkulturen werden sie durch die dämonischen Tierherren ersetzt. Ursprünglich waren es wohl Vegetationsgottheiten, die dämonisiert wurden und schließlich zum Kinderschreck abgesunken sind. Man opferte ihnen, damit sie die Frucht schützen und fördern. Die Präsenz der Korndämonen wird im Wogen des Korns gesehen, und man begleitet diese Erscheinung mit zahlreichen Redensarten etwa „Die Kornmutter ist im Feld“, oder man sagt von der Roggenmöhn (Ostpreußen), sie sitze im Feld und reiche den Kindern ihre schwarzen Titten (=>Langtüttin), so dass sie daran trinken und sterben müssen. Die Personifizierungen, Namen und Gestalten der Korndämonen sind überaus zahlreich, neben der Roggenmuhme, dem Kornmann und dem Kornengel, dem Sichelweib, dem Bilmesschnitter (=>Bilwis), und dem Zitzenweib (=>Langtüttin), sind es vor allem dämonische Tiere: Wolf, Bär, Habergeiß, Schwein und der Kornvater oder die Kornkatze, die zugleich als Kinderschreckgestalten gelten, mit denen man die Kinder vom Betreten der reifenden Kornfelder abhalten will.
Eine der interessantesten Gestalten, die der Forschung viele Rätsel aufgibt, ist in diesem Zusammenhang der (oder die) Bilwis mit einem überaus umfangreichen Spektrum regionaler Namensformen. Am Beispiel des Aufhockers und noch mehr an der Entwicklung der Gestalt des Bilwis wird deutlich, wie wenig präzis die Vorstellungen vom Phänotyp dieser Dämonen sind. Oft sind es nur vage Vorstellungen theriomorpher, anthropomorpher oder dinglicher Art unter denen der Dämon, die dämonische Begegnung, konkretisiert wird. Die Bilwis-Vorstellung wandelt sich im Laufe ihrer Entwicklung der niederen Mythologie zur anthropomorphen Gestalt eines Korndämons und Zauberers. Damit sich jedoch nur sehr unvollkommen die polymorphe Variationsbreite dieser Gestalt andeutet, wird die Schwierigkeit dieser Vorstellung deutlich, wenn etwa Name und Gestalt, Vorstellung und Funktion dieser Dämonen von Landschaft zu Landschaft und über größere Zeiträume hinweg variieren.

Es sind Vegetationsdämonen, die sich im Kornfeld (aber auch in allen anderen Pflanzungen wie Flachs, Bohnen, Mohn, Hopfen usw.) aufhalten. Sie treten in menschlicher (Kornmuhme), als auch in tierischer (Roggenwolf) Gestalt auf. Sie können sowohl männlichen, als auch weiblichen Geschlechts sein. Zweifellos treten Korn- bzw. Vegetationsdämonen bei allen agrarisch orientierten Völkern auf. In Jägerkulturen werden sie durch die dämonischen Tierherren ersetzt. Ursprünglich waren es wohl Vegetationsgottheiten, die dämonisiert wurden und schließlich zum Kinderschreck abgesunken sind. Man opferte ihnen, damit sie die Frucht schützen und fördern. Die Präsenz der Korndämonen wird im Wogen des Korns gesehen, und man begleitet diese Erscheinung mit zahlreichen Redensarten etwa „Die Kornmutter ist im Feld“, oder man sagt von der Roggenmöhn (Ostpreußen), sie sitze im Feld und reiche den Kindern ihre schwarzen Titten (=>Langtüttin), so dass sie daran trinken und sterben müssen. Die Personifizierungen, Namen und Gestalten der Korndämonen sind überaus zahlreich, neben der Roggenmuhme, dem Kornmann und dem Kornengel, dem Sichelweib, dem Bilmesschnitter (=>Bilwis), und dem Zitzenweib (=>Langtüttin), sind es vor allem dämonische Tiere: Wolf, Bär, Habergeiß, Schwein und der Kornvater oder die Kornkatze, die zugleich als Kinderschreckgestalten gelten, mit denen man die Kinder vom Betreten der reifenden Kornfelder abhalten will.
Eine der interessantesten Gestalten, die der Forschung viele Rätsel aufgibt, ist in diesem Zusammenhang der (oder die) Bilwis mit einem überaus umfangreichen Spektrum regionaler Namensformen. Am Beispiel des Aufhockers und noch mehr an der Entwicklung der Gestalt des Bilwis wird deutlich, wie wenig präzis die Vorstellungen vom Phänotyp dieser Dämonen sind. Oft sind es nur vage Vorstellungen theriomorpher, anthropomorpher oder dinglicher Art unter denen der Dämon, die dämonische Begegnung, konkretisiert wird. Die Bilwis-Vorstellung wandelt sich im Laufe ihrer Entwicklung der niederen Mythologie zur anthropomorphen Gestalt eines Korndämons und Zauberers. Damit sich jedoch nur sehr unvollkommen die polymorphe Variationsbreite dieser Gestalt andeutet, wird die Schwierigkeit dieser Vorstellung deutlich, wenn etwa Name und Gestalt, Vorstellung und Funktion dieser Dämonen von Landschaft zu Landschaft und über größere Zeiträume hinweg variieren.

Holzschnitt Habergeiß
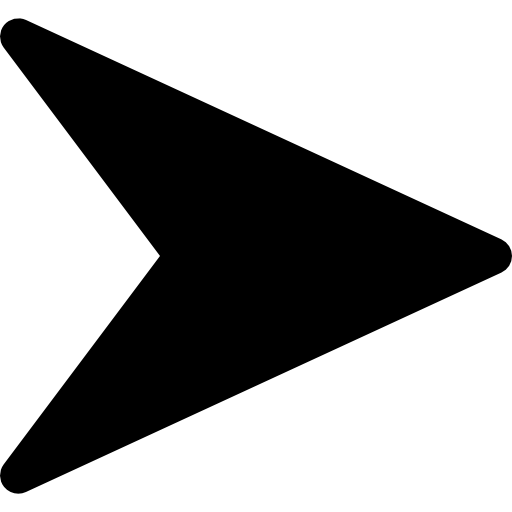
Dämonen im Alltag - Magisches Denken

Holzschnitt Hexen, Quelle: Ulrich Molitor - Tractatus von den weibern [1489]
Viele unsere alltäglichen Vorstellungen resultieren aus einer latent dämonistischen Ätiologie und müssen so als Relikte eines ursprünglich mehr oder weniger kohärenten Systems verstanden werden. Es handelt sich also um universelle Vorstellungen, die nicht auf prälogisches Denken zurückzuführen sind, sondern, wie Claude Lévi-Strauss bemerkt, ihre eigene zweckfreie Logik besitzen. Es ist sein Verdienst, die Sorgfalt, mit der indigene Menschen ihre Umwelt beobachten und deren Erscheinungen systematisierten und klassifizierten, dargestellt und interpretiert zu haben. Damit beschreibt er ein in sich „logisches“ System, das in einer formalen Analogie zu unserer Wissenschaft steht. Unübertrefflich hatte dies schon Honoré de Balzac formuliert, und nicht ohne Grund stellt Lévi-Strauss dessen Ausspruch seinem Buch Traurige Tropen (Tristes Tropiques, 1955) voran: „Niemand ist in seinen Berechnungen so genau wie die Wilden, die Bauern und die Provinzler; wenn sie vom Gedanken zur Wirklichkeit kommen, ist daher alles schon fertig“.
Durch den kulturellen Austausch über Jahrtausende hin sind manche dämonistischen Vorstellungen ebenso wie die damit verbundenen magischen Rituale zu sinnentleerten Gesten säkularisiert worden, und es kommt zu einer ahistorischen Vermischung der Phänomene. Daher treffen wir ständig auf Konglomerate von Quellenmaterial unterschiedlicher Provenienz und einen pagan-christlichen Synkretismus.
Magisches Denken begleitet nach wie vor unser heutiges Leben, das sich auf Logik und Rationalität, Naturwissenschaften und ein materialistisches Weltbild stützt - eine Basis, die jedoch oft als mangelhaft und trotz allem unkontrollierbar erfahren wird. Das magisch-mythische Denken, die magische Weltsicht, ist „bestimmt von der Lehre der ‚universellen Sympathie’, d.h. der Vorstellung, dass alles mit allem verbunden ist.“, so Leander Petzoldt in Magie. Weltbild, Praktiken, Rituale (München 2011)
https://www.chbeck.de/petzoldt-becksche-reihe-6015-magie/product/34264386
Diese grundlegende Analogie, diese wechselseitigen Bezüge und sympathischen Korrelationen, machen sowohl Makrokosmos als auch Mikrokosmos und die Handlungen von Menschen und Göttern - oder profaner: des ‚Schicksals’ - in ihnen verständlich. Die magischen Prinzipien stellen ein vielschichtiges System dar, das sowohl auf Ähnlichkeit als auch auf Gegensätzlichkeit beruht, auf Kontiguität, bei der ein Teil das Ganze repräsentiert (z. B. Reliquien), und auf Nachahmung, die durch entsprechende Rituale ein bestimmtes Ergebnis zu sichern verspricht. Bestimmte Leitmotive, die Spiegelung des Makrokosmos im Mikrokosmos, die Konstruktion von Protagonisten und Antagonisten, von Antinomien und Gegensätzen sind grundsätzliche Strukturen magischen Denkens.

Albrecht Dürer: Magisches Quadrat.
Detail aus dem Kupferstich Melancholia,
dies entnommen aus Agrippas De acculta philosophia
Detail aus dem Kupferstich Melancholia,
dies entnommen aus Agrippas De acculta philosophia
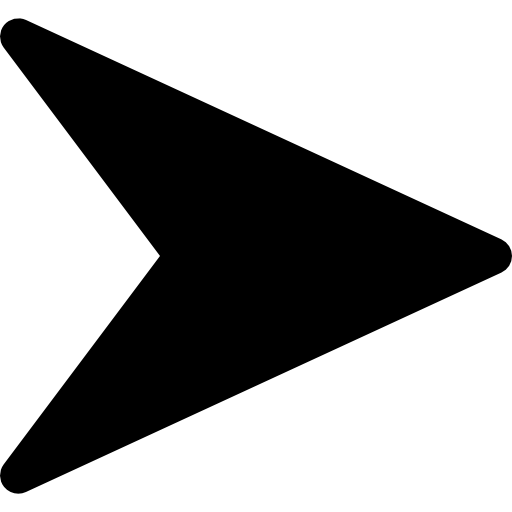
Aufbau der Artikel
1. Nach dem Stichwort erfolgt die Angabe des grammatikalischen Geschlechts, denn dies ist schon im Althochdeutschen schwankend.
So kann es heißen „daz“ oder „die zwerc“; „diu, daz“ oder „der mar“. Dies bedeutet, dass man sich bereits zu dieser Zeit kein
klares Bild von diesen Gestalten machen konnte. Im Falle des Zwerges ist wohl das Neutrum ursprünglich, was bedeutet, dass ein
unklares Etwas anthropomorphisiert wurde. Es folgen weiterhin die verschiedenen Namensformen, auch dialektale. Falls die Dämonenvorstellung
über den deutschsprachigen Raum hinaus verbreitet ist, werden auch fremdsprachige Namensformen ausgeführt.
2. Es folgt die Erklärung (Etymologie) des Namens oder Begriffs und der Versuch, die Entstehung der Namensform, soweit diese zu eruieren ist, zu beschreiben.
3. Aus den gesammelten Informationen und Texten wird sodann versucht, eine Wesensbestimmung bzw. Charakteristik und Phänomenologie der angeführten Wesenheit zu erstellen. Hierbei ist es häufig notwendig, die Ambivalenz im Verhalten einzelner dämonischer Gestalten zu berücksichtigen. In der Regel sind Dämonen unsichtbar, sie können jedoch die (körperliche) Gestalt von natürlichen oder fabelhaften Tieren (zoomorph bzw. theriomorph, also in Tiergestalt) oder menschlicher Wesen (anthropomorph) und sogar Dinggestalt, d. h. von Gegenständen und Metallen annehmen.
4. Weiterhin wird versucht, jeweils die historische Entwicklung der genannten Gestalt nachzuvollziehen soweit sie sich durch Fakten, d. h. in diesem Falle literarische Belege, Erwähnungen, Beschreibungen, bildliche Darstellungen u. a. belegen lässt. Dabei ist es notwendig, den Realitätsgehalt der jeweiligen Quelle zu hinterfragen. Im Einzelfall wird es unumgänglich sein, verschiedene Deutungen anzuführen.
5. Wenn möglich wird das Verbreitungsgebiet der dämonischen Gestalt bzw. der damit verbundenen Glaubensvorstellungen umrissen. Dabei wird auf die Karten zu einzelnen Gestalten in den verschiedenen volkskundlichen Atlanten (Österreich, Deutschland, Schweiz und Osteuropa) und entsprechende Monographien verwiesen.
6. Von besonderer Wichtigkeit ist die wissenschaftliche Interpretation jeder genannten Gestalt, verbunden mit ihrer kulturhistorischen Einordnung. Dabei wird die Summe der Erkenntnisse aus dem jeweils vorliegenden Material unter dem Aspekt ihrer wissenschaftlichen Relevanz gezogen. Ethnologische, psychologische und mentalitätsgeschichtliche Fragestellungen sowie die Ergebnisse der Kulturraumforschung, soweit sie für diese Thematik relevant sind, werden dabei resümierend einbezogen.
7. Zu jedem Artikel wird nicht nur die verwendete sondern auch weiterführende Literatur angegeben, bei verkürzten Hinweisen handelt es sich um in der Einführung gelistete Grundlagenliteratur. Im Einzelfall soll auch auf prägnante Original-Texte verwiesen werden. Außerdem sollen ältere bildliche Darstellungen aus Manuskripten (Bestiarien, Prodigienliteratur, Volksbücher usw.), Inkunabeln, Cimelien die einzelnen Artikel illustrieren. Diese Illustrationen werden nach ihrem Quellenwert ausgewählt.
2. Es folgt die Erklärung (Etymologie) des Namens oder Begriffs und der Versuch, die Entstehung der Namensform, soweit diese zu eruieren ist, zu beschreiben.
3. Aus den gesammelten Informationen und Texten wird sodann versucht, eine Wesensbestimmung bzw. Charakteristik und Phänomenologie der angeführten Wesenheit zu erstellen. Hierbei ist es häufig notwendig, die Ambivalenz im Verhalten einzelner dämonischer Gestalten zu berücksichtigen. In der Regel sind Dämonen unsichtbar, sie können jedoch die (körperliche) Gestalt von natürlichen oder fabelhaften Tieren (zoomorph bzw. theriomorph, also in Tiergestalt) oder menschlicher Wesen (anthropomorph) und sogar Dinggestalt, d. h. von Gegenständen und Metallen annehmen.
4. Weiterhin wird versucht, jeweils die historische Entwicklung der genannten Gestalt nachzuvollziehen soweit sie sich durch Fakten, d. h. in diesem Falle literarische Belege, Erwähnungen, Beschreibungen, bildliche Darstellungen u. a. belegen lässt. Dabei ist es notwendig, den Realitätsgehalt der jeweiligen Quelle zu hinterfragen. Im Einzelfall wird es unumgänglich sein, verschiedene Deutungen anzuführen.
5. Wenn möglich wird das Verbreitungsgebiet der dämonischen Gestalt bzw. der damit verbundenen Glaubensvorstellungen umrissen. Dabei wird auf die Karten zu einzelnen Gestalten in den verschiedenen volkskundlichen Atlanten (Österreich, Deutschland, Schweiz und Osteuropa) und entsprechende Monographien verwiesen.
6. Von besonderer Wichtigkeit ist die wissenschaftliche Interpretation jeder genannten Gestalt, verbunden mit ihrer kulturhistorischen Einordnung. Dabei wird die Summe der Erkenntnisse aus dem jeweils vorliegenden Material unter dem Aspekt ihrer wissenschaftlichen Relevanz gezogen. Ethnologische, psychologische und mentalitätsgeschichtliche Fragestellungen sowie die Ergebnisse der Kulturraumforschung, soweit sie für diese Thematik relevant sind, werden dabei resümierend einbezogen.
7. Zu jedem Artikel wird nicht nur die verwendete sondern auch weiterführende Literatur angegeben, bei verkürzten Hinweisen handelt es sich um in der Einführung gelistete Grundlagenliteratur. Im Einzelfall soll auch auf prägnante Original-Texte verwiesen werden. Außerdem sollen ältere bildliche Darstellungen aus Manuskripten (Bestiarien, Prodigienliteratur, Volksbücher usw.), Inkunabeln, Cimelien die einzelnen Artikel illustrieren. Diese Illustrationen werden nach ihrem Quellenwert ausgewählt.
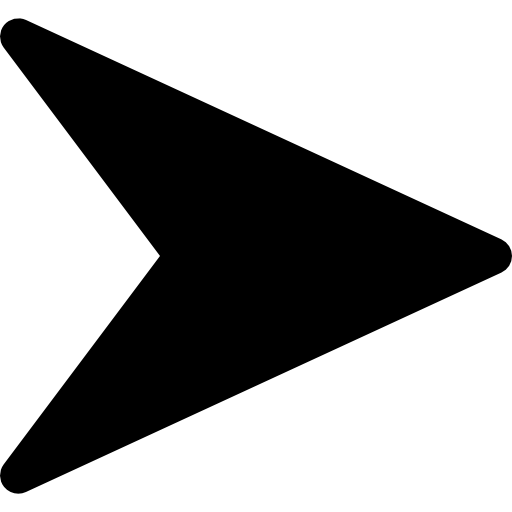
Literaturhinweise
Zur weiteren Lektüre:
Andres, Friedrich: Daimon. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Supplementband III, Stuttgart 1918, Sp. 267–322.
Bächtold-Stäubli, Hanns und E[duard] Hoffmann-Krayer (Hrsg.): Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. 10 Bände. Berlin, Leipzig 1927–1942. Unveränderter Photomechanischer Nachdruck von 1927. Berlin, New York 1987.
Bebber, Jörg van (Hrsg.): Dawn of an Evil Millennium. Horror und Kultur im neuen Jahrtausend. Darmstadt 2011.
Freud, Sigmund: Totem und Tabu. Leipzig, Wien 1913; im Projekt Gutenberg-DE Basierend auf Studienausgabe. Frankfurt am Main 1974
Harmening, Dieter: Art. Dämonologie, in: Wörterbuch des Aberglaubens. Stuttgart 2005.
Lecouteux, Claude: Das Reich der Nachtdämonen. Angst und Aberglaube im Mittelalter. Düsseldorf, Zürich 2001.
Lévi-Strauss, Claude: Tristes Tropiques. 1955, dt. v. Eva Moldenhauer: Traurige Tropen. Frankfurt am Main 1978.
Mannhardt, Wilhelm: Die Korndämonen. Beitrag zur germanischen Sittenkunde. Berlin 1868.
Mannhardt, Wilhelm: Wald- und Feldkulte. 2 Teile, Berlin 1875/1877.
Neubauer-Petzoldt, Ruth: Desillusionierte Sehnsucht und soziale Utopie. Der Umgang mit Dämonen, Märchen und Mythen bei Heinrich Heine, Georg Büchner und Bettina von Arnim. In: Wolfgang Bunzel, Uwe Lemm (Hrsg.): Internationales Jahrbuch der Bettina-von-Arnim-Gesellschaft, Bd. 19, Berlin 2007, S.57-81.
Neubauer-Petzoldt, Ruth: The Year of Magical Thinking – Rituals and Magical Thinking in Autobiographical Literature of Mourning”. In: Magic in Rituals and Rituals in Magic. Hrsg. v. Tatiana Minniyakhmetova, Kamila Velkoborska. Innsbruck, Tartu 2015, p.532-543.
Petzoldt, Leander: Dämonenfurcht und Gottvertrauen. Zur Geschichte und Erforschung unserer Sagen. Darmstadt 1989.
Petzoldt, Leander: Einführung in die Sagenforschung. Konstanz 1999, utb 2002.
Petzoldt, Leander: Historische Sagen, 2 Bde. Mit Anmerkungen und Kommentar. München: 1975. 430 S., 30 Abb. und Karten. 2. Aufl. Hohengehren 2001.
Petzoldt, Leander: Kleines Lexikon der Dämonen und Elementargeister. München 1990, 3. Aufl. 2003;
Petzoldt, Leander: Magie: Weltbild, Praktiken, Rituale. München 2011.
Petzoldt, Ruth und Paul Neubauer (Hrsg.): Demons: Mediators between this World and the Other: Essays on Demonic Beings from the Middle Ages to the Present. Frankfurt a. M., Berlin, Bern, New York 1998.
Strasser, Peter: Neuer Autoritarismus: Über die aktuelle Wiederkehr magischen Denkens in: Neue Zürcher Zeitung vom 04.09.2021: https://www.nzz.ch/meinung/neuer- autoritarismus-die-wiederkehr-magischen-denkens-ld.1633994.
Sybel, Ludwig von: Daimon. In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Band 1,1, Leipzig 1886, Sp. 938 f.
Andres, Friedrich: Daimon. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Supplementband III, Stuttgart 1918, Sp. 267–322.
Bächtold-Stäubli, Hanns und E[duard] Hoffmann-Krayer (Hrsg.): Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. 10 Bände. Berlin, Leipzig 1927–1942. Unveränderter Photomechanischer Nachdruck von 1927. Berlin, New York 1987.
Bebber, Jörg van (Hrsg.): Dawn of an Evil Millennium. Horror und Kultur im neuen Jahrtausend. Darmstadt 2011.
Freud, Sigmund: Totem und Tabu. Leipzig, Wien 1913; im Projekt Gutenberg-DE Basierend auf Studienausgabe. Frankfurt am Main 1974
Harmening, Dieter: Art. Dämonologie, in: Wörterbuch des Aberglaubens. Stuttgart 2005.
Lecouteux, Claude: Das Reich der Nachtdämonen. Angst und Aberglaube im Mittelalter. Düsseldorf, Zürich 2001.
Lévi-Strauss, Claude: Tristes Tropiques. 1955, dt. v. Eva Moldenhauer: Traurige Tropen. Frankfurt am Main 1978.
Mannhardt, Wilhelm: Die Korndämonen. Beitrag zur germanischen Sittenkunde. Berlin 1868.
Mannhardt, Wilhelm: Wald- und Feldkulte. 2 Teile, Berlin 1875/1877.
Neubauer-Petzoldt, Ruth: Desillusionierte Sehnsucht und soziale Utopie. Der Umgang mit Dämonen, Märchen und Mythen bei Heinrich Heine, Georg Büchner und Bettina von Arnim. In: Wolfgang Bunzel, Uwe Lemm (Hrsg.): Internationales Jahrbuch der Bettina-von-Arnim-Gesellschaft, Bd. 19, Berlin 2007, S.57-81.
Neubauer-Petzoldt, Ruth: The Year of Magical Thinking – Rituals and Magical Thinking in Autobiographical Literature of Mourning”. In: Magic in Rituals and Rituals in Magic. Hrsg. v. Tatiana Minniyakhmetova, Kamila Velkoborska. Innsbruck, Tartu 2015, p.532-543.
Petzoldt, Leander: Dämonenfurcht und Gottvertrauen. Zur Geschichte und Erforschung unserer Sagen. Darmstadt 1989.
Petzoldt, Leander: Einführung in die Sagenforschung. Konstanz 1999, utb 2002.
Petzoldt, Leander: Historische Sagen, 2 Bde. Mit Anmerkungen und Kommentar. München: 1975. 430 S., 30 Abb. und Karten. 2. Aufl. Hohengehren 2001.
Petzoldt, Leander: Kleines Lexikon der Dämonen und Elementargeister. München 1990, 3. Aufl. 2003;
Petzoldt, Leander: Magie: Weltbild, Praktiken, Rituale. München 2011.
Petzoldt, Ruth und Paul Neubauer (Hrsg.): Demons: Mediators between this World and the Other: Essays on Demonic Beings from the Middle Ages to the Present. Frankfurt a. M., Berlin, Bern, New York 1998.
Strasser, Peter: Neuer Autoritarismus: Über die aktuelle Wiederkehr magischen Denkens in: Neue Zürcher Zeitung vom 04.09.2021: https://www.nzz.ch/meinung/neuer- autoritarismus-die-wiederkehr-magischen-denkens-ld.1633994.
Sybel, Ludwig von: Daimon. In: Wilhelm Heinrich Roscher (Hrsg.): Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Band 1,1, Leipzig 1886, Sp. 938 f.
Lexikon
A
Aggripiner
pl. (Schnabelkrägen, Kranichmensch)
Als Menschen von schöner Gestalt, mit einem langen, gewundenen Vogelhals mit Menschenkopf und Vogelschnabel
werden sie in den Gesta Romanorum (Kap. 175) beschrieben und von Schedel in seine Weltchronik (Bl. 12)
übernommen. Die Gesta Romanorum deuten die Menschen mit Kranichhals als kluge Richter, die erst lange und
gründlich erwägen, bevor sie ihr Urteil verkünden. Sie sollen in Europa leben. Diese Nachrichten entstammen
vermutlich orientalischen Quellen. Menschen mit Kranichhals tauchen in Monstren- und Prodigienschriften der
frühen Neuzeit, beispielsweise bei Lycosthenes und Aldrovandi auf. Häufig erscheinen sie auch auf Flugblättern
und Pamphleten. Eine solche Kreatur soll nach einer 1660 in Köln erschienenen Flugschrift von einem Kapitän
des Marschalls Milleraye gefangen worden sein und in Nantes zu sehen sein. Wenige Jahre später beschreibt
eine andere Flugschrift das Monster mit Vogelhals als Tataren, der von Graf Nikolaus von Serin gefangen
worden sei. (Wittkower 1984, S. 145).
Im Volksbuch vom Herzog Ernst werden die Schnabelkrägen als Volk der ,,Agrippiner“ bezeichnet und ausführlich geschildert: Herzog Ernst reitet mit seiner Ritterschaft in die Stadt, um eine geraubte Jungfrau zu befreien.
Sein Gefährte Wetzelo rät dem Herzog, wenn der „schneblicht“ König zu Bett gehe, so sollten sie ihm die Jungfrau entreißen. Im Laufe des Gefechtes sticht der König mit seinem spitzen Schnabel die Jungfrau in die Seite, dass ihr das Blut herunterfliest und sie sterben muss. Herzog Ernst ersticht den König und viele Agrippiner mit seinem Schwert und kann sich auf sein Schiff retten.
Im Volksbuch heißt es:
„Nach dem sie nun wol hatten gerastet / giengen sie hin und wider inn dem Saal vmb / und besahen die lustig plaetz / die vmb die Stadt waren / on alles gfehr / so sieht der Graue Wetzelo ein grosses Heer dorther ziehen / die Leut waren also gestalt / von vnden auff biß an Halß warn sie schoen / vnnd oben hatten sie Kranchshälß. Da sprach Wetzelo zu Hertzog Ernsten / Aller liebster Herr / seht jr nicht das vngehewer Volck / das dorther zeucht / da ward es Hertzog Ernst gewar / und sprach zu seinem Gesellen / was sollen wir thun / ich gedenck wir verbergen vns / auff das wir sehen wz sie thun / mit dem verbargen sich die zwen Helden hinderein thuer in einen winckel / und sahen da was die Agrippiner theten. Wie sie nun in die Stad kamen / gienge der Koenig in den saal und bracht mit jm ein schoene Jungfraw / die was von königlichem stammen / die hatte der Koenig mit seinen Bürgern etlich Dienern genommen / die sie hetten sollen führen zu eins Koeniges Son / dem sie warde vermaehelt worden / Aber die Agrippiner hatten sie den Dienern mit gewalt entführt / und sie darzu todt geschlagen. Nun satzte sich der Schneblicht Koenig zu Tisch mit seinen Bürgern / und mercketen wol / das jhnen etlich speiß entzuckt ward / und wussten doch nit wie das zugangen ware. Nun assen und truncken sie sich voll / und fiengen an zu schnattern und singen / da warde mancherley seytenspiel gehoert / gantz wunderliche abenthewer trieben sie / mit springen / tantzen / gaucklen / Nu sasse der Koenig bey der schoenen jungfrawen am Tisch / bot jr zum offtern mal den Schnabel / dz sie jn kuessen solt / Aber die gute Jungfraw was voller trawirigkeit / und wendet das Mauls tets hinumb / und dacht in jr selbest / O Allmechtiger Gott / wer ich vorn diesen Teuffelischen Leuten / Jch wollte das ich wer in einem Waldt / da die Wilden thier wohnen / ich wolt mich nicht hieher wüntschen. Solche trübseligkeit der jungfrawen sahen die zwen Herren hinder der Thür in dem winckel / vnnd sprachen zu einander / wie sollen wir diese Jungfraw erretten […] Sein Gefährte Wetzelo riet dem Herzog Ernst, wenn der König zu Bett gehe, so sollten sie ihm die Jungfrau entreißen. Im Zuge des Gefechtes stach der König mit seinem spitzen Schnabel die Jungfrau in die Seite, dass ihr das Blut herunterfloss und sie sterben musste. Herzog Ernst erstach den König und viele weitere Agrippiner mit seinem Schwert und konnte sich dann auf sein Schiff retten.
Im Volksbuch vom Herzog Ernst werden die Schnabelkrägen als Volk der ,,Agrippiner“ bezeichnet und ausführlich geschildert: Herzog Ernst reitet mit seiner Ritterschaft in die Stadt, um eine geraubte Jungfrau zu befreien.
Sein Gefährte Wetzelo rät dem Herzog, wenn der „schneblicht“ König zu Bett gehe, so sollten sie ihm die Jungfrau entreißen. Im Laufe des Gefechtes sticht der König mit seinem spitzen Schnabel die Jungfrau in die Seite, dass ihr das Blut herunterfliest und sie sterben muss. Herzog Ernst ersticht den König und viele Agrippiner mit seinem Schwert und kann sich auf sein Schiff retten.
Im Volksbuch heißt es:
„Nach dem sie nun wol hatten gerastet / giengen sie hin und wider inn dem Saal vmb / und besahen die lustig plaetz / die vmb die Stadt waren / on alles gfehr / so sieht der Graue Wetzelo ein grosses Heer dorther ziehen / die Leut waren also gestalt / von vnden auff biß an Halß warn sie schoen / vnnd oben hatten sie Kranchshälß. Da sprach Wetzelo zu Hertzog Ernsten / Aller liebster Herr / seht jr nicht das vngehewer Volck / das dorther zeucht / da ward es Hertzog Ernst gewar / und sprach zu seinem Gesellen / was sollen wir thun / ich gedenck wir verbergen vns / auff das wir sehen wz sie thun / mit dem verbargen sich die zwen Helden hinderein thuer in einen winckel / und sahen da was die Agrippiner theten. Wie sie nun in die Stad kamen / gienge der Koenig in den saal und bracht mit jm ein schoene Jungfraw / die was von königlichem stammen / die hatte der Koenig mit seinen Bürgern etlich Dienern genommen / die sie hetten sollen führen zu eins Koeniges Son / dem sie warde vermaehelt worden / Aber die Agrippiner hatten sie den Dienern mit gewalt entführt / und sie darzu todt geschlagen. Nun satzte sich der Schneblicht Koenig zu Tisch mit seinen Bürgern / und mercketen wol / das jhnen etlich speiß entzuckt ward / und wussten doch nit wie das zugangen ware. Nun assen und truncken sie sich voll / und fiengen an zu schnattern und singen / da warde mancherley seytenspiel gehoert / gantz wunderliche abenthewer trieben sie / mit springen / tantzen / gaucklen / Nu sasse der Koenig bey der schoenen jungfrawen am Tisch / bot jr zum offtern mal den Schnabel / dz sie jn kuessen solt / Aber die gute Jungfraw was voller trawirigkeit / und wendet das Mauls tets hinumb / und dacht in jr selbest / O Allmechtiger Gott / wer ich vorn diesen Teuffelischen Leuten / Jch wollte das ich wer in einem Waldt / da die Wilden thier wohnen / ich wolt mich nicht hieher wüntschen. Solche trübseligkeit der jungfrawen sahen die zwen Herren hinder der Thür in dem winckel / vnnd sprachen zu einander / wie sollen wir diese Jungfraw erretten […] Sein Gefährte Wetzelo riet dem Herzog Ernst, wenn der König zu Bett gehe, so sollten sie ihm die Jungfrau entreißen. Im Zuge des Gefechtes stach der König mit seinem spitzen Schnabel die Jungfrau in die Seite, dass ihr das Blut herunterfloss und sie sterben musste. Herzog Ernst erstach den König und viele weitere Agrippiner mit seinem Schwert und konnte sich dann auf sein Schiff retten.
Ahasver

Kupferstich: Ahasver zieht fort aus Jerusalem. Quelle: Landesbibliothek Württemberg
Nach der Sage wollte Jesus, als er mit seinem Kreuz den Weg nach Golgatha gehen musste, beim Hause eines Schusters rasten, der aber vertrieb ihn von seiner Schwelle und ließ ihn nicht ausruhen. Deshalb muss er selbst ruhelos durch die Welt wandern. Dieser Bericht wird verschiedentlich auch in Chroniken aufgenommen, und um 1602 erscheint eine „Kurtze Beschreibung und Erzählung von einem Juden mit Namen Ahasver“. Hier heißt der Jude, der bis dahin Cartaphilus oder Buttadeus genannt wird, erstmals Ahasver.
Im Buch Esther des Alten Testaments ist hebr. „Achaschwerosch“ die Namensform des persischen Königs Xerxes. Dessen jüdische Frau Esther vereitelte einen Pogrom Hamans gegen die Juden, was seither am Purimfest mit Lesungen aus dem Buch Esther feierlich begangen wird.
Das Buch Esther berichtet keine historischen Tatsachen. Auch die jüdische Kultlegende, die das Purimfest begründet, ist eine Legende. Haman, der die Juden ausrotten wollte, fiel in Ungnade und wurde zum Tod am Galgen verurteilt. Der König ließ in seinem Reich verbreiten, die Juden dürften sich gegen ihre Feinde verteidigen. Daraufhin rechneten sie am 13. Adar mit ihren Feinden ab, nahmen jedoch nichts von ihrem Eigentum. Alles das ist historisch nicht belegbar. Die Erzählung ist wohl über dem jüdischen Festkalender in den historischen Kanon benannt. Der Name Ahasver wurde im 17. Jahrhundert in Deutschland zum Übernamen für einen Juden. – Schon im 13. Jahrhundert wird von Pilgern, die aus dem Heiligen Land zurückkehrten, berichtet, sie hätten in Armenien einen Juden gesehen, der zur Buße für sein Verhalten bei der Kreuztragung Jesu wandern müsse und nicht sterben könne. Dieser Bericht wird verschiedentlich auch in Chroniken aufgenommen. Die „Kurtze Beschreibung“ wird initiiert durch eine angebliche Begegnung des Bischofs von Schleswig Johann von Eitzen. Auf den verschiedenen Fassungen dieser Schrift beruht auch das Volksbuch sowie eine französische Ausgabe „Histoire admirable de juif errant“ um 1650. In der volkstümlichen Überlieferung wie auch in der Literatur wird der „Ewige Jude“ dank seiner Unsterblichkeit zu einer Figur, an der sich die Veränderung der Welt ablesen lässt. Im Sinne einer solchen „Geschichtsrevue“ (Frenzel) ist auch Eugen Sues zehnbändiger Bestseller Le julf errant von 1844 angelegt. Vielfach wird die Gestalt jedoch auch zum Symbol der Heimatlosigkeit des Judentums.
Unterm 5. Juni 1564 und der Ortsangabe Schleswig berichtet ein Ungenannter folgendes: Paulus von Eitzen, Doktor der Heiligen Schrift und Bischof zu Schleswig, zu diesem Amte erwählt von Herzog Adolf von Holstein, ein ebenso hochangesehener und glaubwürdiger als durch seine herausgegebenen Schriften berühmter Mann, hat mir und andern Studierenden etliche Mal erzählt: Als er noch zu Wittenberg studierte, sei er einmal im Winter des Jahres 1542 zu seinen Eltern nach Hamburg gereist und habe den ersten Sonntag nach seiner Ankunft in der Kirche während der Predigt einen Mann von auffallendem Äußern gesehen, welcher barfuß der Kanzel gegenüberstand. Derselbe war hochgewachsen, trug langes, über die Schultern herabfallendes Haar und hatte ungeachtet des damals so strengen Winters keine andern Kleider an als ein Paar Hosen, die an den Füßen durch waren, einen bis an die Knie reichenden Rock und darüber einen Mantel, der bis zu den Füßen herabhing. Seines Alters schien er ungefähr fünfzig Jahre zu zählen. Dieser Mann hörte der Predigt mit solcher Andacht zu, dass an ihm keine Bewegung zu bemerken war, außer wann der Name Christi genannt wurde, wobei er sich jedes Mal neigte, an seine Brust schlug und tief aufseufzte. Da sich nun der junge von Eitzen seiner großen Gestalt, seiner Kleidung und Gebärden halber sehr über ihn verwunderte, forschte er ihm sorgfältig nach und vernahm, derselbe habe sich schon etliche Wochen dieses Winters hier aufgehalten und angegeben, er sei ein in Jerusalem geborener Jude, namens Ahasverus, seines Handwerks ein Schuhmacher. Bei der Kreuzigung Christi sei er persönlich zugegen gewesen, seither am Leben geblieben und durch viele Länder gereist. Zur Bestätigung dieser Aussage habe er manches gar genau berichten können, was weder in den Evangelien noch in den Werken anderer Geschichtsschreiber zu finden sei, betreffend die Umstände, von denen das Leiden und die Kreuzigung Christi begleitet gewesen, ebenso betreffend die Ereignisse, welche sich die ersten Jahrhunderte nach Christi Kreuzigung im Morgenlande zugetragen, endlich betreffend die Apostel, wo jeder von ihnen gelebt, gelehrt und gelitten habe.
Die erste Nachricht findet sich in einer in Bologna erschienenen Chronik eines Zisterziensermönchs aus Unteritalien. Er berichtet von Pilgern aus dem Heiligen Land, sie hätten im Jahre 1223 in Armenien einen Juden getroffen, der erzählt habe, er sei bei der Kreuzigung Christi dabei gewesen und habe ihn beschimpft und hätte ihm die Rast vor seinem Haus verwehrt. Dafür müsse er so lange leben und wandern bis Christus wieder komme. Eine weitere Chronik des Roger von Wendover „Flores Historiarum (1228) erzählt von einem Türhüter des Pilatus namens Joseph Kartaphilus, der auf die Wiederkunft Christi warten müsse. Seine Version wird von Matthaeus Parisiensis, wie Wendover ein Mönch aus St. Albans, übernommen. „Beide erzählen, im Jahre 1228 habe ein Erzbischof aus Großarmenien ihr Kloster besucht. Man befragte ihn über den berühmten Joseph, der bei der Kreuzigung zugegen gewesen wäre und als Zeuge christlichen Glaubens noch lebte. Der Erzbischof antwortete, er kenne diesen Joseph, der […] Jesus, als dieser zur Passion wankte, einen Schlag in den Rücken versetzt und gerufen habe: ‘Geh doch schneller, Jesus, was wartest du‘. Jesus habe ihn streng angeblickt und gesprochen: ‘Ich gehe, doch du wirst warten, bis ich zurückkehre.‘ Seither erwarte Cartaphilus die Wiederkehr Jesu. Er war damals 30 Jahre alt. So oft er 100jährig werde, verfalle er in schreckliche Krankheit, genese und werde wieder 30jährig.“ (EJ, I, 1140)
Weitere englische und französische Chroniken aus dem 15. Jahrhundert berichten ebenfalls von dem umhergehenden Juden, der auch Buttadeus (‚Schlage Gott‘) genannt wird. Auch in Spanien und Portugal sowie in Italien (Florenz 1450) wird die Geschichte populär. Starke Verbreitung fand die Erzählung durch die Chronica maior (1531/1580). Diese Chronik wird auch zur Quelle für das deutsche Volksbuch „Kurtze Beschreibung und Erzehlung von einem Juden/ mit Namen Ahasverus/ Welcher bey der Creutzigung Christi selbst persönlich gewesen …“ Bautzen / bey Wolfgang Suchnach/ Anno 1602. Dieses Volksbuch erlebte 46 Auflagen (Neubaur) und fand in ganz Europa Nachahmer, wobei die französische „Histoire Admirable Du Juif-Errant“ (um 1650) eine wirklich ausführliche Biographie darstellt.“ (Frenzel 17). Das Volksbuch von 1602 lässt den Ewigen Juden fast durch die ganze damals bekannte Welt wandern von Schottland bis Italien und von Persien bis Russland, Polen, Livland, Schweden. Das Hauptverbreitungsgebiet ist aber wohl auf die romanischen, germanischen und skandinavischen Ländern beschränkt, mit einigen Nachweisen in den slawischen und finno-ugrischen Ländern. 1868 soll der E. J. dem Mormonen O’Grady in Salt Lake City besucht haben, er soll ihm den Talmud geschenkt und zugleich eine Naturkatastrophe angekündigt haben. Danach soll er noch einmal 1948 in der Herrentoilette der New Yorker Public Library gesehen worden sein.(Anderson 59 f.) Der Name Ahasver wurde erst im 16. Jh. durch die „Kurtze Beschreibung…“ gebräuchlich.
Unter dem Titel „The wandering Jew or the Schoemaker of Jerusalem“ entstanden in England Balladen, während der Stoff in Deutschland vor allem im Volksbuch und im Bänkelsang sowie auf Einblattdrucken popularisiert wurde. Eine besondere Form entwickelte sich in Wallonien, wo die „complaints“ in Balladenform von Bänkelsängern dargeboten wurden. Neben den Volksbüchern nahmen sich auch die Bildende Kunst und die Literatur der Sage an. (Nachweise bei Neubaur und Encyclopaedia Judaica). Hier sind vor allem die 12 Illustrationen Gustave Dorés sowie 60 Holzschnitte von J.J. Gielen (Amsterdam 1931) zu nennen. Bengt af Klintberg publizierte 12 Holzschnitte aus schwedischen Volksbüchern (Jerusalem 1965).
In der volkstümlichen Überlieferung wie auch in der Literatur wird der Ewige Juden dank seiner Unsterblichkeit zu einer „Begegnungsgestalt“, an der sich die Veränderung der Welt ablesen lässt. So heißt es in einer Sage aus Kärnten: „Als ich das erstemal in diese Gegend kam, fand ich eine Wiese mit Sträuchern, das zweitemal eine schöne Stadt . Wenn ich das drittemal komme werde ich einen großen Steinhaufen finden.“ (Petzoldt DS, Nr. 297).
Kolorierter Holzschnitt „Le Juif-errant“ / der wandernde Jude von François Georgin, 1896. Quelle: https://www2.ku.edu/~sma/almanac/peri8.htm

Kolorierter Holzschnitt „Das wahre Porträt des ewigen Juden“ von F. C. Wentzel um 1875.
Alchemie
(Alchymie, Chymia)
Betrachtet man die Alchymie überhaupt;
so findet man an ihr dieselbe Entstehung,
die wir oben bei anderer Art Aberglauben
bemerkt haben. Es ist der Missbrauch
des Echten und Wahren, ein Sprung von der
Idee, vom Möglichen, zur Wirklichkeit, eine
falsche Anwendung echter Gefühle, ein
lügenhaftes Zusagen, wodurch unseren
Liebsten Hoffnungen auch Wünschen
geschmeichelt wird.
(Goethe Werke, Weimar 1893, Bd. 66 S. 207)
(Goethe Werke, Weimar 1893, Bd. 66 S. 207)
„Die Alchemie ist die Morgenröte des naturwissenschaftlichen Zeitalters.“
(Carl Gustav Jung)
(Carl Gustav Jung)
Die Anfänge der A. sind wohl bei den griechischen Naturphilosophen des 5. u. 6. Jh. zu suchen. Wort und Begriff stammen aus dem Arabischen und Griechischen. Al (=Artikel) und Chymea (Griech.). Die praktische Anwendung der A. auf der Suche nach dem Lebenselixier machte keinen Unterschied zwischen organischer und anorganischer Natur. Zudem entwickelte sie einen theoretisch philosophischen Überbau, den die Alchemisten von > Hermes Trismegistos bzw. von dem ägyptischen Gott Toth übernommen hatten. Daher wird sie im Mittelalter als „Hermetische“ Kunst betrachtet. Wahrscheinlich kam die A. im 8. Jh. über arabische Vermittlung nach Europa was auch die arabischen Lehnwörter (Alkohol, Algebra, Algorythmus) in den meisten europäischen Sprachen bezeugen. Zweifellos kann man die A. als vorwissenschaftliche Stufe zur Chemie ansehen. Wichtig war die Verwandlung der Stoffe (Transmutation) auf der Suche nach dem => Stein der Weisen und der Schaffung eines „Lebenselixiers“ (Panacee). Zugrunde liegt die Vorstellung, dass die Metalle zu den verschiedenen Elementen in Beziehung stehen und dass sie ihre Entsprechung in bestimmten Planeten haben. Platons Lehre von der Verwandtschaft aller Dinge bzw. dessen Grundsatz, dass Gleiches das Gleiche sucht (Similia simillibus => Magie) wurde zum Symbol für den Kreislauf der Elemente. Der Kreislauf der Dinge verband den Mikrokosmos mit dem Makrokosmos, alle Dinge auf Erden haben ihre Entsprechung in den Dingen am Himmel, in dem „hermetischen Oben und Unten“ (Superius et inferius Hermetis). Führend waren die Neuplatoniker des 4. bis 7. Jh., die „zu mythischen-orientalisch-ägyptischen Gottheiten => Hermes Trismegistos enge Beziehung“ hatten. (RGG s.v.) Aus der Verbindung arabischer und christlicher Gelehrsamkeit wird die A. im 12. und 13. Jh. auch im Abendland verbreitet. Man kann verschiedene Richtungen ausmachen. Die Anwendung der theoretischen A. auf der Suche nach dem Stein der Weisen. Weiterhin die mystische A., welche die Quintessenz zu finden sucht, um die unedlen Metalle abzulegen (d. h. die Leidenschaften und Sünden); sie sucht nach geistigem Gold, das Paradies wiederzufinden und die Wiedergeburt (Transfiguration), kurz um ein Übermensch zu werden (in den sieben Graden der Perfektion); im 15. und 16. Jh. auch die Königliche Kunst genannt. Und schließlich die gewöhnliche A.; diese sucht einfach die Transmutation, d. h. bei den Griechen die „diplosis“, nämlich das Gewicht von unedlen Metallen durch Legierung mit edlen zu verdoppeln. Das neue Metall, das sich dabei durch Legerung mit Silber ergab, nannte man Asem oder Elektron.
Der Jesuit Athanasius Kircher (1601 – 1680) deckt in seinem Werk „Mundus subterraneus“ die betrügerischen Praktiken der Alchemisten auf. „Sie verbergen gefeiltes Gold oder Silber in ausgehöhlten Stöcken, mit denen sie geschmolzenes unedles Metall umrühren; dabei verbrennt das Holz und das gefeilte Edelmetall wird dem unedlen beigemengt. Andere benutzen Schmelztiegel mit doppelten Böden, in denen sie wiederum gefeiltes Edelmetall verstecken. Beim Umrühren des geschmolzenen Metalls wird diesmal der innere Boden durchstoßen und der gleiche Effekt erzielt.
Im Jahr 1928 wurden zwei Papyrosurkunden aus dem 3. Jh. in Ägypten entdeckt, chemische Codices, die „Rezeptsammlungen für Purpurfärberei, Legierungen, Färben von Metallen, Glas, Edelsteinen“ enthielten. (RGG I 221). In den sog. Hermetischen Schriften (Hermes Tris megistos) drehte sich alles um den „Mercurius (lapis) philosophorum“, dem => Stein der Weisen, der aus unedlen Metallen Gold schaffen konnte. (ebeda)
So entwickelt sich eine für den Außenstehenden unverständliche Geheimsprache, die in Symbolen sprach und als eine „Arkandisziplin“ galt. Fischart äußert sich in seiner Übersetzung von Jean Bodins Werk „De la Daemonomanie de Sorciers (Paris 1580 u. ö) sehr ungehalten: „Entweder schreib, dass man versteht oder des Schreibens müsig geht / willst schreiben, dass man nicht soll wissen so lass das Papier wol unbeschissen“.
Lit.:
Gebelein, H.: Alchemie, München, 1991
Priesner, C.: Geschichte der Alchemie, München, 2011
Federmann, R.: Die königliche Kunst, Wien, Berlin, 1964
Kopp, H.: Die Alchemie in älterer und neuerer Zeit, 1886, Nachdruck 1971
Kock u. a. Geschichte der Astrologie, 2003
Bernus, A. von: Das Geheimnis der Adepten, Sersheim 1956
Berthelot. M.: Die Chemie im Altertum und Mittelalter, Hildesheim 1970
Coudert, A. Der Stein der Weisen, Bern/München 1980
Thorndike, L.: History of Magie and Experimentel Science I-VI, 1923-41
Taylor F.S., The Alchemists Founders of Modern Chemistry, 1961
B
Bannik
m., f. (Bainnik, Baennik, Bajnik, Laz'nik)
Bannik, Quelle: http://www.istorya.ru/book/slavyane/slavyane012.html
B. ist der Saunageist in der russischen, ukrainischen und weißrussischen Folklore. Manchmal hat er eine weibliche Begleitung (bannaia, bainikha). Im Volksglauben ist der B. ein Dämon, der sich hinter dem Saunaofen versteckt. Er sieht aus wie ein alter, kleiner, magerer, nackter Mann, dessen Körper schmutzig und mit Birkenblättern bedeckt ist. Er kann sich verwandeln, manchmal ist er ein Fremder oder ein Haustier oder eine Frau, wie Schischiga, ein Dämon, der diejenigen bestraft, die in die Sauna kommen ohne vorher gebetet zu haben. Es heißt, dass der B. in der Sauna zuschaut, wenn eine Frau sich wäscht. Der B. ist entweder wohlwollend oder ein böser Dämon, wie er gerade in Laune ist. Wenn er ärgerlich ist, schüttet er heißes Wasser über den Kopf des Badenden oder noch schlimmer: er stranguliert ihn. Es gibt verschiedene Methoden den B. zu begütigen. Um ihn nicht in die Sauna hinein zu lassen, vergräbt man unter der Schwelle ein schwarzes Huhn. Vor dem Besuch der Sauna muss man Brot uns Salz opfern. Nach jedem dritten Saunabesuch darf man nicht mehr in die Sauna, weil sich dann die Teufel und Waldgeister dort waschen. Wenn man aber trotzdem hinein geht, gieß der B. heißes Wasser über ihn, oder schält seine Haut ab oder Schischiga schlägt ihn mit einer Birkenrute tot. Wenn man in einem solchen Moment weglaufen will, muss man rückwärtsgehen. Wenn der letzte aus der Sauna geht, muss er ein Fass Wasser, ein Stück Seife und eine Birkenrute für den Dämon zurück lassen. B. schadet den Wöchnerinnen und er kann dem Kind in der Sauna Schaden zufügen. Solche Kinder sind hässlich, haben einen großen Kopf und aufgeblasenen Magen, sie wachsen sehr schlecht, können nicht sprechen und sterben nach drei Jahren. (>Wechselbalg).
Die Sauna ist ein Ort, in dem man die Zukunft erfahren kann. Bevor man die Sauna betritt, muss man die nackte Rückseite durch die halbgeöffnete Tür der Sauna stecken. Wenn der B. die Person mit seinen Klauen berührt, ist es ein schlechtes Vorzeichen, aber wenn er die Person mit seiner weichen Hand berührt, ist es ein gutes Omen. Vor allem an Weihnachten kommen die Mädchen um Mitternacht in die Sauna und halten ihre Hände in das Rauchloch. Wenn der B. die Hand des Mädchens mit seiner haarigen Hand streift, wird das Mädchen einen reichen Mann bekommen. Wenn er mit der glatten Hand des Mädchens Hand streift, heiratet sie einen armen Mann. Der Saunageist kann auch freundlich sein, er kann Wanderern Obdach gewähren und sie vor Teufeln und Waldgeistern schützen. Um in der Sauna zu bleiben, muss man sagen „Saunawirt/Saunaherr, lass mich übernachten“, dann hilft der B. den Wanderern.
Batman
(Fledermaus-Mann)
Ein Kämpfer für Gerechtigkeit und das Gute. Er erscheint in vielen Comics und der Science Fiction Literatur, in Filmen,
Kurzfilmen, Hörspielen und anderen Medien. Erstmals erschienen seine Abenteuer im Mai 1939 in dem Comic Magazin
„Detektive Comics“. Erfunden hat ihn Bob Kane und weiterentwickelt Bill Finger. Hinter der Figur des Batman
versteckt sich (im Film) der Milliardär Bruce Wayne. Der Grund für sein kämpferisches Engagement gegen jede
Art von Verbrechen, Betrug und Bosheit war ein Mord, dem seine Eltern zum Opfer fielen. Mit einer
Fledermausmaske und einem fledermausartigen Umhang bewegt er sich geradezu akrobatisch durch die Lüfte und
besiegt die Feinde zusammen mit seinem Freund Robin. Er benutzte nie eine Waffe.
Vorbild waren wohl die einige Jahre vorher erschienenen Serien „Superman“ und eventuell die Negativfigur „The Bat“, ein Verbrecher, der ein Fledermauskostüm trug. Batman besitzt im Gegensatz zu dem Superman keine übernatürlichen Hilfsmittel. Er ist ein „Dunkler Ritter“, ein Melancholiker, der vor dem düsteren Hintergrund von Gotham City seine Rachsucht ausleben kann.
Die Figur wurde mehrmals verfilmt: „Batman“, 1989. – „Batmans Rückkehr“, 1992. – „Batman Forever“, 1995. – „Batman and Robin“, 1997.
Lit.:
Banhold, L.: Batman. Konstruktion eines Helden. 2. Auflage. 2008
Fricke, H.: Batmans Metamorphosen als intermedialer Superheld in Comic, Prosa und Film: Das Überleben der mythischen Figur, die Urszene – und der Joker. In: iasl (Internationales Archiv für die Sozialgeschichte der Literatur), 2009.
Vorbild waren wohl die einige Jahre vorher erschienenen Serien „Superman“ und eventuell die Negativfigur „The Bat“, ein Verbrecher, der ein Fledermauskostüm trug. Batman besitzt im Gegensatz zu dem Superman keine übernatürlichen Hilfsmittel. Er ist ein „Dunkler Ritter“, ein Melancholiker, der vor dem düsteren Hintergrund von Gotham City seine Rachsucht ausleben kann.
Die Figur wurde mehrmals verfilmt: „Batman“, 1989. – „Batmans Rückkehr“, 1992. – „Batman Forever“, 1995. – „Batman and Robin“, 1997.
Lit.:
Banhold, L.: Batman. Konstruktion eines Helden. 2. Auflage. 2008
Fricke, H.: Batmans Metamorphosen als intermedialer Superheld in Comic, Prosa und Film: Das Überleben der mythischen Figur, die Urszene – und der Joker. In: iasl (Internationales Archiv für die Sozialgeschichte der Literatur), 2009.
Baumkult
(Baumgeist, Weltenbaum)
In Schriften aus dem 6. Jh. werden heidnische Gebräuche, Bäume und Quellen anzubeten, d. h. Baum- und Quellenkulte, als Sakrileg verpönt und noch im 13. Jh. rügt die Provinzialsynode von Trier (1227), man dürfe Bäume und Quellen nicht anbeten (‘adorare fontes et arbores“). Offensichtlich handelt es sich um Votiv-Kulte und Opfermahle an Bäumen und Quellen, die seit dem 6. Jh. belegt sind. Schon in der „Capitulatio de partibus Saxoniae“ Karls des Großen werden kultische Mahlzeiten, die in Zusammenhang mit der Verehrung von in Bäumen und an Quellen lebenden Dämonen veranstaltet wurden, unter Strafe gestellt: „Si quis ad fontes aut arbores vel lucos votum fecerit …et ad honorem daemonum comederet…“. („Wenn einer an Quellen oder Bäumen oder in Hainen ein Gelübde tut oder etwas nach heidnischem Brauch darbringt und zu Ehren der bösen Geister speist , so muss er, wenn er ein Adeliger ist, 60 Schillinge entrichten , wenn ein Freigeborener 30….“ ) Man kann daher davon ausgehen, daß es in Mitteleuropa einen ausgeprägten „vorchristlichen Heilkult an Bäumen, Wassern und Steinen“ (Harmening) gab, der sich im Volksglauben bis in die Neuzeit rudimentär erhalten und in der Vorstellung vom Baumgeist konkretisiert hat. Im 13. Jahrhundert entsteht die sog. „Lieder Edda“, in der die „Völuspa“ (Weissagung der Seherin) enthalten ist, die von der Weltenesche „Yggdrasil“ singt: “Eine Esche weiß ich stehen, heißt Yggdrasil / den hohen Stamm netzt weißer Schaum / davon kommt der Tau, der in die Täler fällt / immergrün steht er über Urds-Brunnen“ Der Stamm der Weltenesche stützt die Erde und Ihr Wipfel reicht bis zum Himmel.. An ihren Wurzeln nagt der Drache Nidhögg, den Odins Adler, der in der Krone des Baumes wohnt, bekämpft. Die Götter besuchen Yggdrasil täglich um hier zu beraten. Nach der Prosa-Edda entstehen die ersten Menschen sogar aus dem Baum: “Als Börs Söhne an den Seestrand gingen, fanden sie zwei Bäume. Sie nahmen die Bäume und schufen die Menschen daraus. Sie gaben ihnen Kleider und Namen, den Mann nannten sie „Ask“ (Esche) und die Frau Embla (Ulme), und von ihnen kommt das Menschengeschlecht“. Heilige Bäume waren in den meisten Kulturen bekannt. Auch die jüdische Menora (siebenarmiger Leuchter) ist ein Symbol des Weltenbaums. In Sibirien gilt die Lärche als Weltenbaum „an der Sonne und Mond in Gestalt eines goldenen und silbernen Vogels auf- und abfliegen“(Sellmann). Der heilige Baum der Germanen war die Donar geweihte Eiche, die kultisch verehrt wurde. Bonifatius fällte die Donar-Eiche 724 in Geismar und verkündete damit den Sieg des Christentums. Die Bibel spricht von zwei Bäumen im Paradies, dem Baum des Lebens und dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse (Gen.2.8f). Das erste Menschenpaar, besonders Eva mit dem Apfel (wobei der Apfel lat. malum heißt, wie das Böse) wird seit Jahrhunderten immer wieder ikonographisch als Symbol für den Sündenfall dargestellt.
Der spätere christliche Wallfahrtskult hat über die interpretatio christiana diese Kulte (z. B. Maria Taferl, Maria Waldrast, Maria Stein) übernommen. Der Baum als Sitz von Geistern, der in seiner wachstumsspendenden Kraft selbst beseelt ist, spielt noch im Volksglauben des 19. Jahrhundert eine bedeutende Rolle. In manchen Gegenden ist der Baum Ort der Kinderherkunft, so heißt er in der Schweiz der „Kindlibaum“. In Österreich, Schlesien und Böhmen opferte man früher Bäumen, indem man die Reste des Weihnachtsmahles unter die Obstbäume schüttete, damit sie viele Früchte trugen. Auch das Aufhängen der menschlichen oder einer tierischen Nachgeburt (Placenta) deutet auf ein Baumopfer hin (Wuttke). Bäume waren Orte der Kommunikation. Im gesellschaftlichen Leben de Mittelalters spielten sie eine besondere Rolle. Unter der „Gerichtslinde“ wurde Recht gesprochen; unter der Dorflinde wurde getanzt und musiziert. Martin Luther sagte: “Die Linde ist uns ein Freude- und Friedebaum.“ Die Linde war ein beliebter Baum von tiefer Symbolik, nicht zuletzt wegen ihrer herzförmigen Blätter. „Unter den Linden“ traf man sich und promenierte, in Berlin, wie unter den Platanen der Ramblas in Barcelona.
Zum 200. Geburtstag der französischen Revolution 1989 pflanzten die Bürgermeister der 36.000 Kommunen Frankreichs Freiheitsbäume. Der erste Freiheitsbaum wurde am 01.05.1790 in der Gemeinde Saint Gaudent aufgestellt: Ein wurzelloser Baum mit einer Jakobinermütze auf der Spitze. Als „Liberty Tree“ verbreitete sich der Brauch schnell auch in den englischen Kolonien im Kampf gegen die von den Engländern eingeführte Stempelsteuer (Stemp akt). Die unmittelbaren Vorfahren der Freiheitsbäume, die zum Teil kultisch verehrt wurden waren die Dorflinde, Erinnerungsbäume und vor allem Maibäume, die auf diese Weise einen neuen Sinn bekamen (Trümpy 9). Die Menschen des Mittelalters hatten zu Bäumen und zur Natur ein sympathetisches Verhältnis. Was dem Lebens- oder Schutzbaum geschah, stieß auch dem Menschen zu. Im Märchen wird der Sympathieglaube, der auf der antiken Lehre von der „Sympathie des Alls“ beruht, besonders deutlich. Die Metaphysik der sympathetischen Zusammenhänge geht auf die Vorstellung von der Umweltbeseelung zurück. In dem Märchen „Die zwei Brüder“(KHM 85) wachsen zwei Lilien zusammen mit den zwei Brüdern auf. Einer zieht in die Fremde, und als eine der Lilien zu verdorren droht, weiß der Bruder, der zu Hause blieb, dass der andere in Gefahr ist und eilt ihm zu Hilfe. Für den Menschen des Mittelalters war die Natur von Geistern und numinosen Wesen beseelt. Das wird in einer Sage aus Schlesien deutlich: „In Waldbäumen wohnt, wie noch jetzt alte Leute glauben, ein höheres Wesen. Nicht jeder Landmann gestattet es, dass man ohne besondere Veranlassung in die Rinde eines Waldbaumes hineinschneide. Er hat, gehört, der angeschnittene Baum blute und die ihm zugefügte Wunde verursache ihm nicht geringere Schmerzen als einem verwundeten Menschen. Wenn man einen bejahrten Holzhacker im Walde belauscht, so kann man hören, wie er dem Baume, den er eben fällen will, Abbitte leistet. Fragt man ihn nach der Ursache… so antwortet er, …. in jedem Baum wohne eine arme Seele, der er dadurch, dass er ihr Abbitte leistet, Erlösung bringt, während sie leiden und im Baumstrunk fortleben müssen, wenn er das unterlasse“. (A. Peter 1867, 5. 30 f.)
In der Volksüberlieferung ist die Erinnerung an eine alte Rechtsstrafe lebendig geblieben. Der Baumfrevler, der Bäume durch abschälen der Rinde zerstörte, traf nach ältestem deutschem Markrecht die sonst seltene Strafe des Ausdärmens. Es wurde ihm so viel Gedärm aus dem Leib gewunden, als es der beschädigten Baumrinde entsprach. Eine Todesstrafe, die wahrscheinlich in Analogie zum Töten der Baumseele stand. Eine solche Erzählung zeichnete Gustav Friedrich Meyer 1928 in Holstein auf: „De Graf von Kletkamp is so grausam weß. De Jungs hebbt em mal de Wicheln afborkt um hebbt sik´n Schalmei maakt. He süüt dat un lett de Jungs de Darms ut´n Lief riten. De hebbt de Öllern um de Wicheln wickeln müß. He hett mit de Pietsch achter eer staan.“
(Mda: Wicheln = Weiden; afborkt = die Rinde abgeschält; Darms ut´n Lief riten = Därme aus dem Leib reißen; Öllern = Eltern; Pietsch = Peitsche; achter eer = hinter ihnen. Burde-Schneidewind 1969, S. 44, Nr. 45; A: G. F. Meyer; Nachlaß 109, A 69.
Sehr intensiv befassten sich skandinavische Forscher mit dem Problem der => Waldgeister Granberg wandte sich gegen die Mythisierung und erklärte, dass es keinerlei Begründungen für den Zusammenhang zwischen den B. und deren Herkunft aus der Baumseele gebe, wie er auch die Vorstellung, dass der B. aus den Glauben an die Götter/Göttinnen der altdeutschen Mythologie hervorgegangen sei, ablehnte. Wichtige Forschungsbeiträge zur Begriffs- und Motivgeschichte leisteten A. Hultkrantz, L. Röhrich, I. Paulson, R. Grambo, C. Lecouteux und E. Pomeranzeva, um nur einige zu nennen.
Lit.:
Harmening 1979
Peter II, 1867
Hauser, A.: Wald und Feld in der alten Schweiz, Zürich 1972
Sellmann, S.: Der Baum. Symbol und Schicksal des Menschen. Karlsruhe 1993 Lurker, M.: Der Baum in Glauben und Kunst … Baden-Baden 1960
Beitl, R.: Der Kinderbaum. Berlin 1942
Keller,W.: Der Lebensbaum, München 1976
Grimm, J.: Deutsche Rechtsaltertümer II, 4. A., Leipzig 1899, S.39 f.
Fehr, H.: Das Recht im Bild, Erlenbach, Zürich 1923, S. 94 f. u. Abb.116, 117, 119
Manhardt, Wald- und Feldkulte, Berlin 1975
Trümpy, M., Der Freiheitsbaum, in: SAV 57 (1961), 103-122.
Granberg, G.: Skogsrået i yngre nordisk folktradition. Uppsala 1935; p. 284, 299.
Hultkrantz, A. (ed.): The Supernatural Owners of Nature. Stockholm 1961.
Röhrich, L.: Europäische Wildgeistersagen. In: Rhein. Jh.b. Vk 10 (1959), 79-162, auch in: Id.: Sage und Märchen. Freiburg 1976, 142-194 (Hiernach zitiert)
Paulson, I.: Schutzgeister und Gottheiten des Wildes (der Jagdtiere und Fische) in Nordeurasien. Stockholm 1961.
Grambo, R.: The Lord of the Forest and Mountain Game in the More Resent Folk Traditions of Norway. In: Fabula 7 (1965), 33-52.
Lecouteux, C.: Eine Welt im Abseits. Zu niederen Mythologie und Glaubenswelt des Mittelalters. Dettelbach 2000.
Pomeranzeva, E.: Mifologičeskie personaži v russkom fol’klore. Moskva 1975; p. 183-185.
Der spätere christliche Wallfahrtskult hat über die interpretatio christiana diese Kulte (z. B. Maria Taferl, Maria Waldrast, Maria Stein) übernommen. Der Baum als Sitz von Geistern, der in seiner wachstumsspendenden Kraft selbst beseelt ist, spielt noch im Volksglauben des 19. Jahrhundert eine bedeutende Rolle. In manchen Gegenden ist der Baum Ort der Kinderherkunft, so heißt er in der Schweiz der „Kindlibaum“. In Österreich, Schlesien und Böhmen opferte man früher Bäumen, indem man die Reste des Weihnachtsmahles unter die Obstbäume schüttete, damit sie viele Früchte trugen. Auch das Aufhängen der menschlichen oder einer tierischen Nachgeburt (Placenta) deutet auf ein Baumopfer hin (Wuttke). Bäume waren Orte der Kommunikation. Im gesellschaftlichen Leben de Mittelalters spielten sie eine besondere Rolle. Unter der „Gerichtslinde“ wurde Recht gesprochen; unter der Dorflinde wurde getanzt und musiziert. Martin Luther sagte: “Die Linde ist uns ein Freude- und Friedebaum.“ Die Linde war ein beliebter Baum von tiefer Symbolik, nicht zuletzt wegen ihrer herzförmigen Blätter. „Unter den Linden“ traf man sich und promenierte, in Berlin, wie unter den Platanen der Ramblas in Barcelona.
Zum 200. Geburtstag der französischen Revolution 1989 pflanzten die Bürgermeister der 36.000 Kommunen Frankreichs Freiheitsbäume. Der erste Freiheitsbaum wurde am 01.05.1790 in der Gemeinde Saint Gaudent aufgestellt: Ein wurzelloser Baum mit einer Jakobinermütze auf der Spitze. Als „Liberty Tree“ verbreitete sich der Brauch schnell auch in den englischen Kolonien im Kampf gegen die von den Engländern eingeführte Stempelsteuer (Stemp akt). Die unmittelbaren Vorfahren der Freiheitsbäume, die zum Teil kultisch verehrt wurden waren die Dorflinde, Erinnerungsbäume und vor allem Maibäume, die auf diese Weise einen neuen Sinn bekamen (Trümpy 9). Die Menschen des Mittelalters hatten zu Bäumen und zur Natur ein sympathetisches Verhältnis. Was dem Lebens- oder Schutzbaum geschah, stieß auch dem Menschen zu. Im Märchen wird der Sympathieglaube, der auf der antiken Lehre von der „Sympathie des Alls“ beruht, besonders deutlich. Die Metaphysik der sympathetischen Zusammenhänge geht auf die Vorstellung von der Umweltbeseelung zurück. In dem Märchen „Die zwei Brüder“(KHM 85) wachsen zwei Lilien zusammen mit den zwei Brüdern auf. Einer zieht in die Fremde, und als eine der Lilien zu verdorren droht, weiß der Bruder, der zu Hause blieb, dass der andere in Gefahr ist und eilt ihm zu Hilfe. Für den Menschen des Mittelalters war die Natur von Geistern und numinosen Wesen beseelt. Das wird in einer Sage aus Schlesien deutlich: „In Waldbäumen wohnt, wie noch jetzt alte Leute glauben, ein höheres Wesen. Nicht jeder Landmann gestattet es, dass man ohne besondere Veranlassung in die Rinde eines Waldbaumes hineinschneide. Er hat, gehört, der angeschnittene Baum blute und die ihm zugefügte Wunde verursache ihm nicht geringere Schmerzen als einem verwundeten Menschen. Wenn man einen bejahrten Holzhacker im Walde belauscht, so kann man hören, wie er dem Baume, den er eben fällen will, Abbitte leistet. Fragt man ihn nach der Ursache… so antwortet er, …. in jedem Baum wohne eine arme Seele, der er dadurch, dass er ihr Abbitte leistet, Erlösung bringt, während sie leiden und im Baumstrunk fortleben müssen, wenn er das unterlasse“. (A. Peter 1867, 5. 30 f.)
In der Volksüberlieferung ist die Erinnerung an eine alte Rechtsstrafe lebendig geblieben. Der Baumfrevler, der Bäume durch abschälen der Rinde zerstörte, traf nach ältestem deutschem Markrecht die sonst seltene Strafe des Ausdärmens. Es wurde ihm so viel Gedärm aus dem Leib gewunden, als es der beschädigten Baumrinde entsprach. Eine Todesstrafe, die wahrscheinlich in Analogie zum Töten der Baumseele stand. Eine solche Erzählung zeichnete Gustav Friedrich Meyer 1928 in Holstein auf: „De Graf von Kletkamp is so grausam weß. De Jungs hebbt em mal de Wicheln afborkt um hebbt sik´n Schalmei maakt. He süüt dat un lett de Jungs de Darms ut´n Lief riten. De hebbt de Öllern um de Wicheln wickeln müß. He hett mit de Pietsch achter eer staan.“
(Mda: Wicheln = Weiden; afborkt = die Rinde abgeschält; Darms ut´n Lief riten = Därme aus dem Leib reißen; Öllern = Eltern; Pietsch = Peitsche; achter eer = hinter ihnen. Burde-Schneidewind 1969, S. 44, Nr. 45; A: G. F. Meyer; Nachlaß 109, A 69.
Sehr intensiv befassten sich skandinavische Forscher mit dem Problem der => Waldgeister Granberg wandte sich gegen die Mythisierung und erklärte, dass es keinerlei Begründungen für den Zusammenhang zwischen den B. und deren Herkunft aus der Baumseele gebe, wie er auch die Vorstellung, dass der B. aus den Glauben an die Götter/Göttinnen der altdeutschen Mythologie hervorgegangen sei, ablehnte. Wichtige Forschungsbeiträge zur Begriffs- und Motivgeschichte leisteten A. Hultkrantz, L. Röhrich, I. Paulson, R. Grambo, C. Lecouteux und E. Pomeranzeva, um nur einige zu nennen.
Lit.:
Harmening 1979
Peter II, 1867
Hauser, A.: Wald und Feld in der alten Schweiz, Zürich 1972
Sellmann, S.: Der Baum. Symbol und Schicksal des Menschen. Karlsruhe 1993 Lurker, M.: Der Baum in Glauben und Kunst … Baden-Baden 1960
Beitl, R.: Der Kinderbaum. Berlin 1942
Keller,W.: Der Lebensbaum, München 1976
Grimm, J.: Deutsche Rechtsaltertümer II, 4. A., Leipzig 1899, S.39 f.
Fehr, H.: Das Recht im Bild, Erlenbach, Zürich 1923, S. 94 f. u. Abb.116, 117, 119
Manhardt, Wald- und Feldkulte, Berlin 1975
Trümpy, M., Der Freiheitsbaum, in: SAV 57 (1961), 103-122.
Granberg, G.: Skogsrået i yngre nordisk folktradition. Uppsala 1935; p. 284, 299.
Hultkrantz, A. (ed.): The Supernatural Owners of Nature. Stockholm 1961.
Röhrich, L.: Europäische Wildgeistersagen. In: Rhein. Jh.b. Vk 10 (1959), 79-162, auch in: Id.: Sage und Märchen. Freiburg 1976, 142-194 (Hiernach zitiert)
Paulson, I.: Schutzgeister und Gottheiten des Wildes (der Jagdtiere und Fische) in Nordeurasien. Stockholm 1961.
Grambo, R.: The Lord of the Forest and Mountain Game in the More Resent Folk Traditions of Norway. In: Fabula 7 (1965), 33-52.
Lecouteux, C.: Eine Welt im Abseits. Zu niederen Mythologie und Glaubenswelt des Mittelalters. Dettelbach 2000.
Pomeranzeva, E.: Mifologičeskie personaži v russkom fol’klore. Moskva 1975; p. 183-185.
Bruder Rausch
(engl. Friar Rush, Broder Rusche, Ruske)
Wer ist wohl, der nicht hätt‘ gelesen
von Bruder Rauschens tollem Wesen?
und wer des Lesens ganz unkundig ist,
verspürte selbst wohl seine Teufelslist.
(Volksbuch)
Bruder Rausch ist die Adaptation eines dänischen Volksbuchs ins Englische (Friar Rush), das die Faulheit und Völlerei der Mönche geißelt .Dies war ein beliebtes Thema in England und auf dem Kontinent seit dem 14. Jh., als Witze über den liederlichen Lebenswandel der Mönche im Schwange waren.
Mit der Zeit nahm Friar Rush mehr und mehr Züge eines >“Hobgoblin“ an und verlor den Charakter eines teuflischen Tricksters. Es beginnt mit einem Auftrag aus der Hölle in Ben Jonsons Erzählung, in der B.R.in ein Kloster eintritt und die Klosterbrüder in Versuchung führen soll, zur Völlerei, Müßiggang und Wollust, bis er entlarvt wird und in ein unbewohntes Schloss verbannt wird. Nach einiger Zeit kann er das Schloss verlassen und übernimmt eine andere Aufgabe. Er stellt einen Mönch bloß, der sich in eine Frau verliebt hat. Dann erzählt er seinem neuen Herrn, seine junge Frau sei vom Teufel besessen, und holt einen Abt, um einen Exorzismus durchzuführen.
Da er weder in die Hölle noch in den Himmel aufgenommen werden kann, verwandelt er sich und geistert als >Irrlicht (ignis fatuus, Will ó the Wisp) umher. Im Jahr 1520/30 wird die Sage erstmals in Deutschland aufgezeichnet, (Peuckert 139). Zur gleichen Zeit findet sie sich auch in der „Zimmerischen Chronik“ (4, 134f). Das deutsche Volksbuch von B.R. (1842) geht wahrscheinlich auf das englische Chapbook zurück. Der Name „Rausch“ stammt vermutlich aus dem niederdeutschen „Rusche“ und bezeichnet einen Poltergeist. In einer Nachdichtung des Germanisten Wilhelm Hertz wird er beschrieben: Ein Männlein „glattwangig, zart und wohlgestallt von einem roten Hemdlein umwallt, ein rotes Hütchen in den Locken“ (S. 13). Diese Beschreibung entspricht freilich nicht dem Helden des Volksbuchs. Dieser arbeitet als Küchenjunge im Kloster Eßrom bei Helsingör. Hier treibt er sieben Jahre sein Unwesen und verführt die Mönche zu einem üppigen Leben. Der Koch, der ihn wegen seines liederlichen Lebenswandels strafte, stößt er in einen Kessel mit siedendem Wasser und nimmt dann dessen Stelle ein. Er ist eine teuflische Gestalt und wird schließlich durch einen Exorzismus des Abts in einen Berg verbannt.
Bei Hertz erscheint er als eine Gestalt der germanischen Niederen Mythologie und nicht als teuflische Gestalt des Christentums. Er ist uralt und wird durch einen Zufall aus seinem siebenhundertjährigen Schlaf geweckt. Er bittet den Abt um Aufnahme in das Kloster: „Wir sind so gerne, wo Menschen sind“ (S. 16). Dies ist die Übersetzung der Äußerung des Kobolds bei Caesarius von Heisterbach: “Magna est mihi consolatio esse cum filiis hominum“ (Dial. Mir. 5, 36) Er verführt die Mönche zu einem lasterhaften Leben. „Er singt vom Reich der Zwerge, vom Todeskuss der Wasserfrauen, vom Elbentanz auf Waldesauen, von eigenem und fremdem Liebesleid“, beschreibt Hertz sein Wesen ganz im Sinne der Romantik. Abweichend vom Volksbuch kehrt der Kobold nach seiner Ausweisung wieder zurück ins Kloster und lebt dort als kleiner roter Teufel vom Guardian und den Mönchen geduldet.
Lit.:
Volksbücher Nr. 52 um 1842. Leipzig, bei Otto Wigand; Floeck, Elementar Geister, S. 94 ff.; W. Hertz, Bruder Rausch. Ein Klostermärchen, Stuttgart 1882; Briggs, S. 181 f. Peuckert, W.-E: 1965.
Petzoldt, L.: Dt. Schwänke, (Reklam 1970 Nachdruck Hohengähren 2002)
Priebsch, R.: Die Grundfabel und Entwicklungsgeschichte d. Dichtung von „Bruder Rusche“, Prag 1908
Werbow, S.N.: The Wealthy Pessant and his Benefice (in Fs. L. Wolff, Neumünster 1962)
Priebsch, R.: Die Grundfabel und Entwicklung der Dichtung von „Bruder Rausch“, Prag 1908
von Bruder Rauschens tollem Wesen?
und wer des Lesens ganz unkundig ist,
verspürte selbst wohl seine Teufelslist.
(Volksbuch)
Bruder Rausch ist die Adaptation eines dänischen Volksbuchs ins Englische (Friar Rush), das die Faulheit und Völlerei der Mönche geißelt .Dies war ein beliebtes Thema in England und auf dem Kontinent seit dem 14. Jh., als Witze über den liederlichen Lebenswandel der Mönche im Schwange waren.
Mit der Zeit nahm Friar Rush mehr und mehr Züge eines >“Hobgoblin“ an und verlor den Charakter eines teuflischen Tricksters. Es beginnt mit einem Auftrag aus der Hölle in Ben Jonsons Erzählung, in der B.R.in ein Kloster eintritt und die Klosterbrüder in Versuchung führen soll, zur Völlerei, Müßiggang und Wollust, bis er entlarvt wird und in ein unbewohntes Schloss verbannt wird. Nach einiger Zeit kann er das Schloss verlassen und übernimmt eine andere Aufgabe. Er stellt einen Mönch bloß, der sich in eine Frau verliebt hat. Dann erzählt er seinem neuen Herrn, seine junge Frau sei vom Teufel besessen, und holt einen Abt, um einen Exorzismus durchzuführen.
Da er weder in die Hölle noch in den Himmel aufgenommen werden kann, verwandelt er sich und geistert als >Irrlicht (ignis fatuus, Will ó the Wisp) umher. Im Jahr 1520/30 wird die Sage erstmals in Deutschland aufgezeichnet, (Peuckert 139). Zur gleichen Zeit findet sie sich auch in der „Zimmerischen Chronik“ (4, 134f). Das deutsche Volksbuch von B.R. (1842) geht wahrscheinlich auf das englische Chapbook zurück. Der Name „Rausch“ stammt vermutlich aus dem niederdeutschen „Rusche“ und bezeichnet einen Poltergeist. In einer Nachdichtung des Germanisten Wilhelm Hertz wird er beschrieben: Ein Männlein „glattwangig, zart und wohlgestallt von einem roten Hemdlein umwallt, ein rotes Hütchen in den Locken“ (S. 13). Diese Beschreibung entspricht freilich nicht dem Helden des Volksbuchs. Dieser arbeitet als Küchenjunge im Kloster Eßrom bei Helsingör. Hier treibt er sieben Jahre sein Unwesen und verführt die Mönche zu einem üppigen Leben. Der Koch, der ihn wegen seines liederlichen Lebenswandels strafte, stößt er in einen Kessel mit siedendem Wasser und nimmt dann dessen Stelle ein. Er ist eine teuflische Gestalt und wird schließlich durch einen Exorzismus des Abts in einen Berg verbannt.
Bei Hertz erscheint er als eine Gestalt der germanischen Niederen Mythologie und nicht als teuflische Gestalt des Christentums. Er ist uralt und wird durch einen Zufall aus seinem siebenhundertjährigen Schlaf geweckt. Er bittet den Abt um Aufnahme in das Kloster: „Wir sind so gerne, wo Menschen sind“ (S. 16). Dies ist die Übersetzung der Äußerung des Kobolds bei Caesarius von Heisterbach: “Magna est mihi consolatio esse cum filiis hominum“ (Dial. Mir. 5, 36) Er verführt die Mönche zu einem lasterhaften Leben. „Er singt vom Reich der Zwerge, vom Todeskuss der Wasserfrauen, vom Elbentanz auf Waldesauen, von eigenem und fremdem Liebesleid“, beschreibt Hertz sein Wesen ganz im Sinne der Romantik. Abweichend vom Volksbuch kehrt der Kobold nach seiner Ausweisung wieder zurück ins Kloster und lebt dort als kleiner roter Teufel vom Guardian und den Mönchen geduldet.
Lit.:
Volksbücher Nr. 52 um 1842. Leipzig, bei Otto Wigand; Floeck, Elementar Geister, S. 94 ff.; W. Hertz, Bruder Rausch. Ein Klostermärchen, Stuttgart 1882; Briggs, S. 181 f. Peuckert, W.-E: 1965.
Petzoldt, L.: Dt. Schwänke, (Reklam 1970 Nachdruck Hohengähren 2002)
Priebsch, R.: Die Grundfabel und Entwicklungsgeschichte d. Dichtung von „Bruder Rusche“, Prag 1908
Werbow, S.N.: The Wealthy Pessant and his Benefice (in Fs. L. Wolff, Neumünster 1962)
Priebsch, R.: Die Grundfabel und Entwicklung der Dichtung von „Bruder Rausch“, Prag 1908
C
Charivari
(Katzenmusik, Haberfeldtreiben)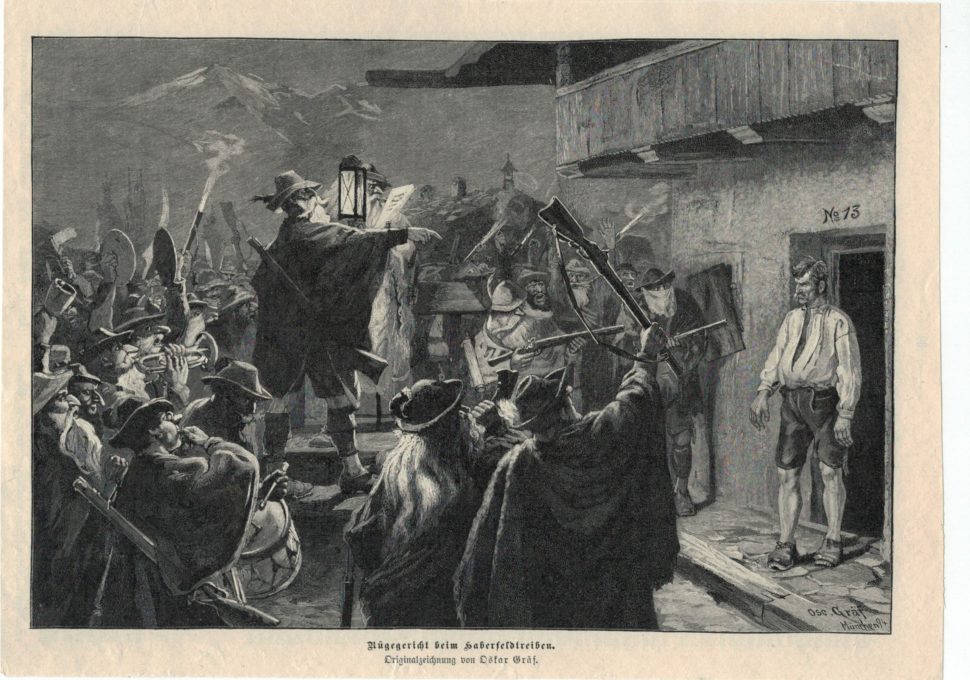
Haberfeldtreiben, Zeichnung von Otto Gräf 1894
Die Bezeichnung Charivari „Krawall, Lärm“ von frz./lat. charivarium (?) K. Simrock und J. Grimm vermuteten eine Ableitung aus dem lat.: „xcaper“ (=>capricorn) Ziegenbock.
Eine Art der Selbstjustiz im süddeutschen Raum. Bei bestimmten Missständen, die nicht justiziabel waren, schlossen sich Dorfbewohner zusammen und verkleideten sich bis zur Unkenntlichkeit (als Tiere, Dämonen, Teufel, Katzen, Böcke) und zogen zu dem Anwesen des Betreffenden und lärmten mit allen möglichen Instrumenten und rügten das Verhalten, indem sie den Fall in Vers fassten und vortrugen. Solche rituellen Vermummungen sind auch in anderen Volksbräuchen (Klaubauf, Krampus). Ein solcher Fall konnte die Heirat eines Mädchens aus einem anderen Dorf wenn der Bräutigam sich nicht an das ungeschriebene Gesetz hielt, seine Ablöse, z. B. ein Fass Bier zu spendieren. Ein solcher Fall z. B. die „Eselshochzeit“ in Hütten in der Eifel (1958). Der Bräutigam sollte rückwärts auf einem Esel durch das Dorf geführt werden; er weigerte sich jedoch und der Fall ging an das Landgericht. Der Spruch der Haberer lautete: „Hiltrud und Leo zur Ehre und uns zum Plasir klopfen wir den Schari – Bari sechs Wochen und drei Tage.“ Der Fall zog weite Kreise und es kamen bis zu 15000 Zuschauer. Fortan wurde das junge Ehepaar geächtet und die Wochenzeitung „Die Zeit“ (5.12.1958) titelte: „Ein Brauch, der zum Missbrauch wurde“.
Lit.:
Kaltenstadler, W.: Charivari, Katzenmusik, Haberfeldtreiben, in: Ch. Ferstl (ed): Mit Schmeller von Puhai bis Hinterklebach, Regensburg 2015, S. 211 - 246
D
Der gelbe Zwerg
(le nain jeune; The yellow dwarf)
Ein Märchen aus der Sammlung der Madame d’Aulnoy (1698) heisst es: „Der gelbe Zwerg wohnt auf einem Orangenbaum oder woanders“ … er ernährt sich von Orangen, hat eine gelbe Jacke an, große Ohren, keine Haare und ist nur ellengroß. Zweimal versucht er die Königin und ihre Tochter Toutebelle (wunderschön) zu einem Heiratsversprechen zu bewegen. Schließlich heiratet Toutebelle den König der Goldminen. Am Tag der Hochzeit fordert der gelbe Zwerg auf einer Katze als Reittier das Eheversprechen. Er zwingt den König zum Zweikampf und ersticht ihn. Auch die Prinzessin stirbt. Angeregt durch Edmund Spensers „The Fairy Queen“ (1590-96) ist das Feenmärchen in England bekannter als in Frankreich: „Mother Bunch and the yellow dwarf“ (1807) sowie zahlreiche Bearbeitungen für die Bühne und als Volksbuch (Chepbook). Z. B. „Harlequin knight oft the gold mines“ (1820). Dabei spielen zahlreiche Feen eine Rolle.
Lit.:
Diederichs, U.: Who’s who im Märchen, München 1995
Lit.:
Diederichs, U.: Who’s who im Märchen, München 1995
Dracus
(Dracil, Dracae , Draci)
Bereits Gerrvasius von Tilbury erwähnt 1211 die Wassergeister des Rhonetals, die Frauen zu sich locken, indem sie die Form von goldenen Bechern (!) annehmen und im Strom schwimmen. Griff eine Frau nach dem Becher, nahmen sie wieder ihre dämonische Gestalt an und zogen die Frau in die Tiefe, wo sie Hebammendienste leisten oder auf die Kinder des Wassermanns aufpassen mußten. (Tilbury, Otia Imperialia, ed. Liebrecht, 135f). Hier wird gewissermaßen die erste Hebammengeschichte erzählt. Er erzählt weiter, dass eine Frau sich die Augen mit einer Zaubersalbe der Draci bestreicht , um besser sehen zu können. Als sie auf dem Land einen Wassermann trifft, verliert sie wieder diese Gabe.
Auch Walter Scott gibt diese Sagen des Gervasius wieder:“ Es ist erwiesen, dass diese Erzählungen in fast allen Teilen der Highlands und Lowlands of Scotland bekannt sind“ . Am Schluß erzählt Gervasius dien Sage von dem „dracus“ , der einen Menschen erwartet, um ihn zu ertränken (Motiv: Die Stunde ist da, aber der Mann nicht). Vgl. das Gedicht von W.Scott “The water – Kelpie. Wie unausweichlich dieses Schicksal ist,zeigt folgende Sage:“Eines Abends gingen ein paar Burschen nicht weit von Michelstadt am Wasser der Mümlming (Fluss) her, da rief eine Stimme unter der Brücke hervor:“Die Stund ist da, und der Mann noch nicht“.Zu gleicher Zeit kam von dem nahen Berge ein Mann „herabgeleufen und wollte ins Wasser hineinspringen . Die Burschen hielten ihn fest und redeten ihm zu , er gab aber keine Antwort. Sie nehmen ihn mit ins Wirtshaus und wollten ihm Wein zu trinken geben. Da ließ er seinen Kopf auf den Tisch fallen und war tot.“ ((J,W.Wolf, Hessische Sagen, Leipzig 1853, Nr.201).
Dass Wassergeister sich der Menschen bemächtigen und sie zu sich hinunterziehen, steht schon bei Paracelsus in dessen „Liber de Nymphis …“ (1561). Er erklärt auch das Begehren der Wasserdämonen nach menschlichen Ehepartnern: Da sie keine Seele besitzen , versuchen sie durch die Verbindung mit den Menschen an dessen Transzendenz teilzuhaben, zumal der mittelterliche Mensch der Auffassung war, dass jede Art von Lebewesen , die auf dem Land leben, seine Entsprechung im Wasser habe.
Lit.:
Liebrecht, F.:Des Gervasius von Tilbury OTIA IMPERIALIA.., Hannover 1856.-Theophrastus von Hohenheim , gen. Paracelsus : Liber de nymphis , sylphies, pygaeis, et salamandris et de caeteris spritibus“ ed. R. Blaser, Bern 1960 – Petzoldt,L.: Das Universum der Dämonen und die Welt des ausgehenden Mitttelelters, In: U.Müller u. W . Wunderlich: Dämonen, ;onster. Fabelwesen, St.Gallen 1990, 39-57.
Auch Walter Scott gibt diese Sagen des Gervasius wieder:“ Es ist erwiesen, dass diese Erzählungen in fast allen Teilen der Highlands und Lowlands of Scotland bekannt sind“ . Am Schluß erzählt Gervasius dien Sage von dem „dracus“ , der einen Menschen erwartet, um ihn zu ertränken (Motiv: Die Stunde ist da, aber der Mann nicht). Vgl. das Gedicht von W.Scott “The water – Kelpie. Wie unausweichlich dieses Schicksal ist,zeigt folgende Sage:“Eines Abends gingen ein paar Burschen nicht weit von Michelstadt am Wasser der Mümlming (Fluss) her, da rief eine Stimme unter der Brücke hervor:“Die Stund ist da, und der Mann noch nicht“.Zu gleicher Zeit kam von dem nahen Berge ein Mann „herabgeleufen und wollte ins Wasser hineinspringen . Die Burschen hielten ihn fest und redeten ihm zu , er gab aber keine Antwort. Sie nehmen ihn mit ins Wirtshaus und wollten ihm Wein zu trinken geben. Da ließ er seinen Kopf auf den Tisch fallen und war tot.“ ((J,W.Wolf, Hessische Sagen, Leipzig 1853, Nr.201).
Dass Wassergeister sich der Menschen bemächtigen und sie zu sich hinunterziehen, steht schon bei Paracelsus in dessen „Liber de Nymphis …“ (1561). Er erklärt auch das Begehren der Wasserdämonen nach menschlichen Ehepartnern: Da sie keine Seele besitzen , versuchen sie durch die Verbindung mit den Menschen an dessen Transzendenz teilzuhaben, zumal der mittelterliche Mensch der Auffassung war, dass jede Art von Lebewesen , die auf dem Land leben, seine Entsprechung im Wasser habe.
Lit.:
Liebrecht, F.:Des Gervasius von Tilbury OTIA IMPERIALIA.., Hannover 1856.-Theophrastus von Hohenheim , gen. Paracelsus : Liber de nymphis , sylphies, pygaeis, et salamandris et de caeteris spritibus“ ed. R. Blaser, Bern 1960 – Petzoldt,L.: Das Universum der Dämonen und die Welt des ausgehenden Mitttelelters, In: U.Müller u. W . Wunderlich: Dämonen, ;onster. Fabelwesen, St.Gallen 1990, 39-57.
E
Elbentritsch, m.
(Ilbetritsch, Elfetritsch, Elbertrötsch, Trilpetritsch)
Fabelhafter, im Volksglauben der Pfalz und des angrenzenden südwestdt. Sprachraums bekannter „Vogel“, dessen Gestalt nach der Phantasie des Erzählers ausgestaltet werden kann. Elbentritsche treten meist in der Mehrzahl auf.
Mit der Redensart „Elbentritschen fangen“ narrt man Ortsfremde, indem man ihnen vorspiegelt, jene sagenhaften Tiere ließen sich nächtlich auf dem Feld in Säcken fangen. Der Fremde wird veranlasst, einen Sack aufzuhalten, und die einheimischen Begleiter entfernen sich, um ihm die Elbentritschen zuzutreiben. Je nach Auffassungsgabe steht der Fänger sehr lange im Dunkeln und wartet auf das Jagdwild.
Ähnliche Foppereien sind in verschiedenen Landschaften unter der Bezeichnung „Rasselböcke fangen“, „Hammelmäuse“ oder „Dilldappen fangen“ verbreitet.
In Oberbayern kennt man ‚Greißen‘ oder ‚Kreißen‘, otterähnliche Tiere, die in Gebirgsbächen leben sollen; auch sie fängt man in Säcken.
Das Kerngebiet der Verbreitung der Elbentritschen und der damit: verbundenen Neckbräuche liegt im Rheinfränkischen. Eine dialektologische Untersuchung erwähnt eine ähnliche Gestalt aus Nordfrankreich bzw. im deutschen Grenzland, der „Daru“ genannt wird. An sie knüpft sich die Anekdote „dass ein etwas einfältiger Bursche … veranlasst wird, in einer kalten Winternacht auf den „Daru“ zu lauern. Dass der Daru in den deutschen Versionen der Erzählungen … u. a. „Ilbentrütsch“ (f), Ilbentriche (n), Elpentrötsch (m), usf. heißt, bestätigt seinen dämonischen Charakter, in dem das erste Element …. Wohl mit Elb, Elfe, usf. identisch ist.
Verschiedentlich wurde der Versuch gemacht, die Namen und die damit verbundenen Vorstellungen mythologisch zu deuten; möglicherweise steht hinter den Elbentritschen, Rasselböcken, Dilldappen und Greißen eine ältere dämonische Gestalt, die im Laufe der Zeit nicht mehr verstanden wurde und so zum Neckgeist herabsank.
Sprachlich wäre eine Verbindung zu Elbe (=>Alp), dem Druckgeist und Nachtdämon denkbar. Der zweite Bestandteil des Wortes wird unterschiedlich etymologisch abgeleitet, einerseits von Trutsch (=>Trut), das würde bedeuten‚ „der vom Alp Getretene“. Ähnliches sagt eine andere Ableitung von dem Verb ‚triezen‘, ‚trirzen‘ (necken, quälen) der vom Alp Gequälte (=>Wolpertinger).
Lit. :
Becker, A.: Pfälzer Volkskunde. Bonn 1925
Mulch, R.: Elbentritschen und Verwandtes, in: Hess. Bl. f. Vk. 49/50 (1958) S.176-194; 51/52 (1960) S. 170-217
Jaberg, K.: Krankheitsnamen, Metaphorik und Dämonie. In: SAV 47, 1951, P. 92)
Mit der Redensart „Elbentritschen fangen“ narrt man Ortsfremde, indem man ihnen vorspiegelt, jene sagenhaften Tiere ließen sich nächtlich auf dem Feld in Säcken fangen. Der Fremde wird veranlasst, einen Sack aufzuhalten, und die einheimischen Begleiter entfernen sich, um ihm die Elbentritschen zuzutreiben. Je nach Auffassungsgabe steht der Fänger sehr lange im Dunkeln und wartet auf das Jagdwild.
Ähnliche Foppereien sind in verschiedenen Landschaften unter der Bezeichnung „Rasselböcke fangen“, „Hammelmäuse“ oder „Dilldappen fangen“ verbreitet.
In Oberbayern kennt man ‚Greißen‘ oder ‚Kreißen‘, otterähnliche Tiere, die in Gebirgsbächen leben sollen; auch sie fängt man in Säcken.
Das Kerngebiet der Verbreitung der Elbentritschen und der damit: verbundenen Neckbräuche liegt im Rheinfränkischen. Eine dialektologische Untersuchung erwähnt eine ähnliche Gestalt aus Nordfrankreich bzw. im deutschen Grenzland, der „Daru“ genannt wird. An sie knüpft sich die Anekdote „dass ein etwas einfältiger Bursche … veranlasst wird, in einer kalten Winternacht auf den „Daru“ zu lauern. Dass der Daru in den deutschen Versionen der Erzählungen … u. a. „Ilbentrütsch“ (f), Ilbentriche (n), Elpentrötsch (m), usf. heißt, bestätigt seinen dämonischen Charakter, in dem das erste Element …. Wohl mit Elb, Elfe, usf. identisch ist.
Verschiedentlich wurde der Versuch gemacht, die Namen und die damit verbundenen Vorstellungen mythologisch zu deuten; möglicherweise steht hinter den Elbentritschen, Rasselböcken, Dilldappen und Greißen eine ältere dämonische Gestalt, die im Laufe der Zeit nicht mehr verstanden wurde und so zum Neckgeist herabsank.
Sprachlich wäre eine Verbindung zu Elbe (=>Alp), dem Druckgeist und Nachtdämon denkbar. Der zweite Bestandteil des Wortes wird unterschiedlich etymologisch abgeleitet, einerseits von Trutsch (=>Trut), das würde bedeuten‚ „der vom Alp Getretene“. Ähnliches sagt eine andere Ableitung von dem Verb ‚triezen‘, ‚trirzen‘ (necken, quälen) der vom Alp Gequälte (=>Wolpertinger).
Lit. :
Becker, A.: Pfälzer Volkskunde. Bonn 1925
Mulch, R.: Elbentritschen und Verwandtes, in: Hess. Bl. f. Vk. 49/50 (1958) S.176-194; 51/52 (1960) S. 170-217
Jaberg, K.: Krankheitsnamen, Metaphorik und Dämonie. In: SAV 47, 1951, P. 92)
F
Frau Hitt
(Frau Hütt, Frauhütt, Frau Hüt)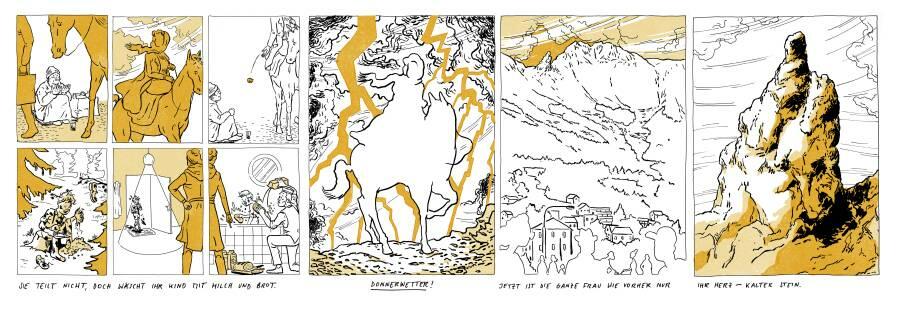
Haltestellenillistration zu Frau Hitt bei Innsbruck
Bezeichnung einer Tiroler Sagengestalt, die an einen merkwürdig geformten Felsen in der Nordkette oberhalb Innsbrucks geknüpft ist. Die Sage erzählt, dass auf dem Gebirge nördlich Innsbrucks eine hartherzige und verschwenderische Riesenkönigin, Frau Hirt, mit ihrem Söhnlein inmitten grüner Wiesen und reicher Acker wohnte. Als eines Tages das Kind in einen Morast geraten war und völlig verschmutzt zu ihr kam, ließ sie es mit Brot reinigen. Ob dieses Frevels erhob sich ein Unwetter, das die grünen Almen und fruchtbaren Acker verschlang. Frau Hirt und ihr Söhnlein aber wurden versteinert und stehen heute noch inmitten des kahlen Gebirges.
Diese ätiologische Sage, die zwei seltsam geformte Felszacken deutet, gehört zu den Frevelsagen und im weiteren Sinne zu den Verwandlungssagen, wie sie bereits in der Bibel (Lots Weib) und in Ovids „Metamorphosen“ berichtet werden. Sie gehen davon aus, dass eine einst paradiesische Landschaft durch menschliche Schuld zur Wüste oder wie hier zu einem kahlen Gebirge wird.
Wie aus einem Kircheninventar von 1384 des Dorfes Höuing am Fuße der Nordkette hervorgeht, wurde der ganze Bereich der Gebirgskette als ‚Perg Hütt‘ bezeichnet. Diese Benennung taucht auch noch 1500 im Jagdbuch Kaiser Maximilians auf als „Peru Fraw Huet“ bzw. früher „Hittenperg“. Untersuchungen von Einsterwalder machen es wahrscheinlich, daß der Name ‚Hitt‘ von dem am Fuße der Nordkette liegenden Dorf Hötting (das seiner seits auf das altbajuwarische Patronym des 7. Jhs. ‚Hetin‘ zurück zuführen ist) abgeleitct bzw. übertragen wurde. Mit dcr Frevekage von Frau Hitt wurde, wie in vielen vergleichbaren Fällen (gossene Alm, Blümeisa die Fe über Hötting als Verurs.a cherin der unfruchtbaren und rauhen Gebirgslandschaft erklärt.
Lit.:
Finsterwalder 1972
G
Glückshaube
(lat. pileus naturalis, caput galeatum, Gluckshaut, Westerhuet, mhd. huetelin, Barwat)
Ein Teil der Embryionalhaut, die manchmal bei der Geburt dem Säugling anhaftet.
In der Antike benutzte man sie zum =>Wahrsagen (Amniomantie) Wenn ein Kind mit einer G. geboren wird, galt das als Zeichen für zukünftiges Glück und es kann Geister sehen. Die Anwendungen für zauberische Zwecke und zum Schutz sind vielfältig. Sie soll kugelfest machen, soll bei Prozessen vor Gericht helfen (HdA), soll Feuer bannen und ist ein wirksames Heilmittel.
Einen Zauber mit der G. schildert der Jesuit Martin Delrio. „Eine verabscheuungswürdige Person besorgte sich ein Stückchen von der Haut, in die ein Säugling gehüllt ist, wenn er das Licht der Welt erblickt. Sie verwünschte diese Glückshaut über dem bloßen Stein des Altars, versteckte sie dort und ließ heimlich fünf Messen darüber zelebrieren. Dann taufte sie den Hautfetzen auf den Namen der Person, die verzaubert werden sollte, und zerrieb ihn zu Pulver, besprengte ihn mit Taufwasser und unterwarf ihn den üblichen Taufzeremonien. Inzwischen wurde sie festgenommen und muss nun die Strafe für ihr Verbrechen verbüßen.“
Auch in der Literatur hat die G. Eingang gefunden. In Charles Dickens‘ Roman „David Copperfield“ wird der Protagonist mit einer G. geboren. Sie soll Glück bringen und wird z. B. von Seeleuten als Talisman erworben. Doch in Dickens‘ Roman will sie niemand kaufen.
Lit.:
Wuttke § 305
Grimm DM 728
In der Antike benutzte man sie zum =>Wahrsagen (Amniomantie) Wenn ein Kind mit einer G. geboren wird, galt das als Zeichen für zukünftiges Glück und es kann Geister sehen. Die Anwendungen für zauberische Zwecke und zum Schutz sind vielfältig. Sie soll kugelfest machen, soll bei Prozessen vor Gericht helfen (HdA), soll Feuer bannen und ist ein wirksames Heilmittel.
Einen Zauber mit der G. schildert der Jesuit Martin Delrio. „Eine verabscheuungswürdige Person besorgte sich ein Stückchen von der Haut, in die ein Säugling gehüllt ist, wenn er das Licht der Welt erblickt. Sie verwünschte diese Glückshaut über dem bloßen Stein des Altars, versteckte sie dort und ließ heimlich fünf Messen darüber zelebrieren. Dann taufte sie den Hautfetzen auf den Namen der Person, die verzaubert werden sollte, und zerrieb ihn zu Pulver, besprengte ihn mit Taufwasser und unterwarf ihn den üblichen Taufzeremonien. Inzwischen wurde sie festgenommen und muss nun die Strafe für ihr Verbrechen verbüßen.“
Auch in der Literatur hat die G. Eingang gefunden. In Charles Dickens‘ Roman „David Copperfield“ wird der Protagonist mit einer G. geboren. Sie soll Glück bringen und wird z. B. von Seeleuten als Talisman erworben. Doch in Dickens‘ Roman will sie niemand kaufen.
Lit.:
Wuttke § 305
Grimm DM 728
H
Habergeiß
(lat. pileus naturalis, caput galeatum, Gluckshaut, Westerhuet, mhd. huetelin, Barwat)
Habergeiß, Holzschnitt
Das nächtliche Gelächter, Kichern, Fauchen und Meckern der Habergeiß erschreckt den Wanderer. Nach der Volksüberlieferung ist die Habergeiß ein dämonischer Vogel, der unverwundbar ist, und der häufig Todesfälle ankündigt.
Sie ist Totenvogel und Kinderschreck zugleich, und ihre Begegnung endet meist unheilvoll.
Weder Name noch Bedeutung der dämonischen Gestalt können eindeutig erklärt werden. Vielleicht handelt es sich auch um einer Korndämon, der als Ziege oder >Dreibein mit einem Ziegenkopf und einem Vogelleib vorgestellt wird. Vonbun schreibt: sie sei ein Vogel mit gelbem Gefieder und der Stimme einer Ziege.
Wahrscheinlich steht hinter dem Glauben an die Habergeiß das durch einen Nachtvogel verursachte Geräusch, das dem in abergläubischen Vorstellungen befangenen Menschen Angst einjagte. So lässt sich vermuten, dass es sich um die Rufe der Bekassine oder der Nachtschwalbe (Caprimulgus europaeus), die volkstümlich ‚Ziegenmelker‘ genannt wird, handelt. Der Name leitet sich einerseits von dem meckernden Ruf des Vogels ab, andererseits auch von dem Glauben, dass der Vogel nachts die Ziegen aussauge. Für die Entstehung der Vorstellung von der Habergeiß aus dem nächtlichen Gehaben des Ziegenmelkers spricht auch‚ die Etymologie des Namens, die vermutlich nichts mit Hafer zu tun hat, sondern auf ‚caper‘ (lat. ‚capra‘ Ziege) zurückgeht.
Im Erntebrauch wird eine aus dem Stroh der letzten Garbe gebundene Gestalt Habergeiß genannt. Es handelt sich um einen Rügebrauch; die Figur wird auf dem zuletzt abgeernteten Feld aufgestellt.
Auch im winterlichen Maskenbrauchtum Österreichs geht die Habergeiß mit: Zwei Burschen unter einem Umhang führen einen aus Holz geschnitzten Ziegenkopf mit und necken die Umstehenden. Der Habergeiß im bayerischen und österreichischen Raum entspricht der Klapperbock oder Schnabbuck im Norddeutschen als Brauchgestalt.
Lit.:
Lochner-Hüttenbach, F.: Zum Namen der Habergeiß, in: Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft 13 (1967)
Vonbun, P.J.: Beiträge zur dt. Mythologie, …, Chur, 1862

Habergeiß und Krampus. Zeichnung von Johannes Mayerhofer , ca. Ende 19. Jhdt.
I
Irrlicht, n
(ignis fatuus, Irrlüchte, Dröglicht, Irdlicht)
Das optische Phänomen des Irrlichts ist unter den verschiedensten Bezeichnungen auf der ganzen Welt bekannt. Engl. wird es „Will-o-the-wisp“, in Australien Quinnslicht“, niederländisch „Dwaallicht“, schwedisch „Irrlbos“, frz. „feu foller“, italienisch „fuoco fatuo“ genannt. Die Bezeichnungen sind von Landschaft zu Landschaft verschieden. Allgemein aber herrscht der Glaube, dass es sich um die Seelen umgehender Toter handelt.
Oft sind es blaue Flämmchen oder feurige Erscheinungen, die über sumpfigem Gelände, aber auch auf Friedhöfen beobachtet werden. Die Vorstellungen vom Irrlicht, das so genannt wird, weil man glaubt, dass es den Wanderer in die Irre führe, geht nicht über das 16. Jh. zurück. Luther erklärt Irrlichter als „Schwebende tewffel, qui homines in pericula ducunt (die die Menschen in Gefahr bringen)“. In zahlreichen Schriften der frühen Aufklärung (S. Hentschel: „Disputantio … de igne fatuo“, Wittenberg 1652) wird eine Erklärung versucht. In Hübners „Curieusers … Lexikon“ (Leipzig 1717, 8, 813) wird eine naturwissenschaftlich-rationale Erklärung angeboten: „Irrwische, Irrlichter, werden also genannt, weil sie hin und her fahren, und die Leute irrend machen. Es ist eine schwefelichte Materia, nicht hoch von der Erden und findet sich gemeiniglich um die sumpfigen Oerter, Kirch-Höfe, Wald-Städte und Bergwercke, da grosse schwefelichte Dünste aus der Resolution Cörper in die Höhe steigen, die Gestalt einer kleinen Fackel oder Lichtes präsentieren, welches hernach hin und her fahret, wo es sein Nutriment findet. Sie pflegen dem Arhem, Gange, Flucht und geschwinden Lauffe der Menschen und Thiere zu folgen, welches seine natürliche Ursache hat, und billich der Luft zuzuschreiben, als welche diese Flammen nach sich ziehen oder auch forttreiben. Zuweilen hat auch der Teufel sein Spiel, und führet die Leute durch solche Liter in das Wasser und an andere gefährliche Oerter.“
Der Glaube an das Irrlicht erwuchs wohl aus natürlichen Wahrnehmungen des nachts sichtbaren phosphoreszierenden Holzes, den Johanniswürmchen. Diese Wahrnehmungen verbunden sich mit dem Volksglauben von den Wiedergängern und ruhelosen Tieren, insbesondere mit der christlichen Vorstellung, dass die Seelen ungetauft verstorbener Kinder auf diese Weise umgehen müssen, bis sie erlöst werden. In Niedersachsen heißt es: „Die Irrlichter, welche im Niederdeutschen erwisch, irlüchte, nachtlüchte, stöhenlicht (seltenlicht), störlepel (stürlepelken) genannt werden, sind die Seelen der ungetauften Kinder, die nicht hinauf, das heißt in den Himmel können. Betet der Mensch, wenn er sie sieht, so kommen sie ganz nahe heran, flucht er, so gehen sie fort.“
Lit.:
Freudenthal, H.: Das Feuer in deutschen Glauben und Brauch, Berlin 1931
Oft sind es blaue Flämmchen oder feurige Erscheinungen, die über sumpfigem Gelände, aber auch auf Friedhöfen beobachtet werden. Die Vorstellungen vom Irrlicht, das so genannt wird, weil man glaubt, dass es den Wanderer in die Irre führe, geht nicht über das 16. Jh. zurück. Luther erklärt Irrlichter als „Schwebende tewffel, qui homines in pericula ducunt (die die Menschen in Gefahr bringen)“. In zahlreichen Schriften der frühen Aufklärung (S. Hentschel: „Disputantio … de igne fatuo“, Wittenberg 1652) wird eine Erklärung versucht. In Hübners „Curieusers … Lexikon“ (Leipzig 1717, 8, 813) wird eine naturwissenschaftlich-rationale Erklärung angeboten: „Irrwische, Irrlichter, werden also genannt, weil sie hin und her fahren, und die Leute irrend machen. Es ist eine schwefelichte Materia, nicht hoch von der Erden und findet sich gemeiniglich um die sumpfigen Oerter, Kirch-Höfe, Wald-Städte und Bergwercke, da grosse schwefelichte Dünste aus der Resolution Cörper in die Höhe steigen, die Gestalt einer kleinen Fackel oder Lichtes präsentieren, welches hernach hin und her fahret, wo es sein Nutriment findet. Sie pflegen dem Arhem, Gange, Flucht und geschwinden Lauffe der Menschen und Thiere zu folgen, welches seine natürliche Ursache hat, und billich der Luft zuzuschreiben, als welche diese Flammen nach sich ziehen oder auch forttreiben. Zuweilen hat auch der Teufel sein Spiel, und führet die Leute durch solche Liter in das Wasser und an andere gefährliche Oerter.“
Der Glaube an das Irrlicht erwuchs wohl aus natürlichen Wahrnehmungen des nachts sichtbaren phosphoreszierenden Holzes, den Johanniswürmchen. Diese Wahrnehmungen verbunden sich mit dem Volksglauben von den Wiedergängern und ruhelosen Tieren, insbesondere mit der christlichen Vorstellung, dass die Seelen ungetauft verstorbener Kinder auf diese Weise umgehen müssen, bis sie erlöst werden. In Niedersachsen heißt es: „Die Irrlichter, welche im Niederdeutschen erwisch, irlüchte, nachtlüchte, stöhenlicht (seltenlicht), störlepel (stürlepelken) genannt werden, sind die Seelen der ungetauften Kinder, die nicht hinauf, das heißt in den Himmel können. Betet der Mensch, wenn er sie sieht, so kommen sie ganz nahe heran, flucht er, so gehen sie fort.“
Lit.:
Freudenthal, H.: Das Feuer in deutschen Glauben und Brauch, Berlin 1931